Intrenion
Konzeption eines Webangebots zur Vermittlung von IT-Dienstleistungen
Christian Ullrich
30. Juli 2015
Zusammenfasung
Diese Arbeit untersucht die Unterstützung von Unternehmen beim Einkauf von IT-Dienstleistungen durch einen Online-Marktplatz. IT-Leiter deutscher Unternehmen geben im Rahmen einer Befragung Aufschluss darüber, wie sie beim Einkauf von IT unterstützt werden könnten. Die Befragten geben wichtige Hinweise auf die konkrete Ausgestaltung des Konzepts.
Der zweite Teil beinhaltet die Entwicklung des Konzepts auf Basis der vorangegangenen Befragung. Dieses baut auf den bekannten Business Canvas auf. Neben der Problematik und den Aktivitäten sind insbesondere der Wertbeitrag für die Unternehmen und das Geschäftsmodell des Konzepts wichtig. Kernbestandteil ist eine Webanwendung mit Anbieterverzeichnis und Ausschreibungsplattform, wie sie in ähnlicher Form von bestehenden digitalen Marktplätzen bekannt sind. Wichtigste Ergänzung sind Dokumentvorlagen, mit denen die Unternehmen IT-Architekturen und Leistungsbeschreibungen als Bestandteile einer Ausschreibung (RFP) erstellen können. Diese Dokumentvorlagen sind besonders wichtig, um den Ausschreibungsprozess der Unternehmen wesentlich zu vereinfachen.
Auf Basis des Konzepts zeigt eine prototypische Implementierung in Form einer Webanwendung eine mögliche Umsetzung des Anbieterverzeichnisses und der Ausschreibungsplattform. Sie soll aufzeigen, wie der Such- und Ausschreibungsprozess bei den Unternehmen vereinfacht werden kann.
Abschließende Betrachtungen ermöglichen einen Blick auf mögliche Weiterentwicklungen des Konzepts. Diese Arbeit hat den Anspruch als Beispiel für die Entwicklung von Geschäftsmodellen an Hochschulen zu dienen.
Abstract
This thesis examines the support of businesses in the sourcing of IT services by an online marketplace. As part of a survey, CIOs of German companies provide information about how they could be assisted in the purchase of IT. Respondents provide important information on the specific design of the concept.
The second part contains the development of the concept based on the previous survey. This builds on the familiar business canvas. In addition to the problems and the activities, the value added for the companies and the business model of the concept are particularly important. The key component is a web application with the service provider directory and tendering platform, as they are known in a similar way to existing digital marketplaces. The most important complement is templates with which the companies can create IT architectures and service specifications as parts of a request for proposal (RFP). These templates are particularly important to simplify the tendering process of the companies significantly.
Based on the concept, a prototypical implementation of a web application shows a possible implementation of the service provider directory and the tendering platform. It should show how the research and sourcing process can be simplified for the companies.
Concluding remarks allow a view to possible enhancements of the concept. This work should serve as an example for the development of business models at universities.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Problem und Lösungsansatz
- 3 Darstellung des Konzepts
- 4 Implementierung eines Prototyps
- 5 Abschluss
- Literaturverzeichnis
1 Einführung
Informationstechnologie ist aus der heutzutage nicht mehr wegzudenken. Anwender nutzen sie täglich auf verschiedenste Weise: Smartphones, Fernseher, mittlerweile auch Uhren. Aber auch die Arbeit ist mittlerweile nahezu vollständig digitalisiert: Gemeinsames Arbeiten über Kontinente hinweg ermöglichen neue Formen der Kollaboration. Trends wie Data-Analytics und Cloud-Computing ermöglichen gänzlich neue Geschäftsmodelle.
Und doch bleibt Informationstechnologie in Unternehmen eine hochkomplexe Angelegenheit. Die Einstellung des Supports für Windows XP durch Microsoft hat gezeigt, dass selbst ein vergleichsweise simples Upgrade des Desktop-Betriebssystems für viele Unternehmen eine Herausforderung darstellt. Von einigen Unternehmen und weiten Teilen der öffentlichen Verwaltung waren und sind Hiobsbotschaften bezüglich der Umstellung zu hören. Obwohl das nahende Ende der Unterstützung jahrelang bekannt ist, wurde nicht oder viel zu spät gehandelt.
Somit zeigt sich, dass selbst der Erhalt und die Erneuerung der IT-Infrastruktur immer noch eine hochkomplexe Angelegenheit ist. Abhilfe sollen externe IT-Dienstleister schaffen, die die interne IT-Organisation mit weiteren Ressourcen unterstützen. Immer öfter erfolgt aber auch eine weitergehende Auslagerung der IT in Form eines langfristigen IT-Outsourcings. Insbesondere Standardleistungen (englisch Commoditites: Gebrauchsgüter), wie der Betrieb der Infrastruktur, sind nicht strategisch relevant und werden daher kostengünstig extern eingekauft.
Doch auch dieser Einkaufsprozess von IT-Dienstleistungen bringt einen nicht zu unterschätzenden Aufwand mit sich: Insbesondere die Definition der Anforderungen, das Ausschreibungsverfahren, die Suche und Auswahl des passenden IT-Dienstleisters und die spätere Zusammenarbeit mit diesem können komplex sein. Die Vergabe an einen externen IT-Dienstleister steigert zwar oftmals die Qualität der Leistungserbringung, bringt aber auch einen gesteigerten Bedarf an Verwaltung mit sich. Insbesondere Projekte in der IT sind dafür bekannt, den Kostenrahmen zu sprengen oder gänzlich zu scheitern.
Diese Arbeit untersucht aufbauend auf bekannten Konzepten die Möglichkeit der Vereinfachung des Einkaufs von IT-Dienstleistungen. Dazu soll ein Online-Marktplatz IT-Dienstleistungen zwischen Anwenderunternehmen (Einkäufer) und IT-Dienstleistern (Verkäufer) vermitteln. Da IT-Dienstleistungen komplexer sind als Gartenmöbel oder Ferienwohnungen, ist das aus anderen Bereichen bekannte Konzept des Online-Marktplatzes schwieriger zu adoptieren, als vielleicht auf den ersten Blick ersichtlich.
1.1 Digitale Marktplätze
Der Austausch von Gütern erfordert Märkte, welche schon lange von Informationstechnologie beeinflusst werden. Aber erst das Internet ermöglicht nicht nur die Beschleunigung des Austauschprozesses, sondern auch die vereinfachte Teilnahme von deutlich mehr Marktteilnehmern an diesen Austauschprozessen.
Über Online-Marktplätze, bekannteste Beispiele sind eBay und Amazon Marketplace, lassen sich praktisch beliebige Güter handeln. Sie geben potenziellen Käufern Überblick über unzählige Waren verschiedenster Art. Besondere Aufmerksamkeit erhält das Konzept dadurch, dass auch exotische Nischenprodukte gehandelt werden können. (englisch Long Tail) Durch die Effizienzsteigerung des Austauschprozesses finden mehr Waren zu Käufern. Interessant ist das Konzept des Online-Marktplatzes insbesondere deshalb, weil der Aufwand Leistungen (Produkte und Dienstleistungen) einzukaufen, dramatisch sinkt. Damit sinken die Transaktionskosten des Marktaustauschprozesses, wodurch sich der Handel intensiviert.
Das Konzept des digitalen Marktplatzes wird seit einigen Jahren auch auf den Handel von Dienstleistungen und den Handel zwischen Unternehmen ausgedehnt. Die Erweiterung auf Dienstleistungen ist naheliegend, wobei viele Geschäftsmodelle erst mit einem digitalen Marktplatz möglich sind.
Insbesondere ad-hoc-Leistungen, wie innerstädtische Mitfahrzentralen (Uber) sind erst durch eine Internet-Plattform möglich. Andere Konzepte, wie die Wohnungsvermittlung (Airbnbn) oder die Arbeitsplatzsuche werden durch eine Webplattform dramatisch vereinfacht. Von einem transparenten, effizienteren Markt profitieren beide Seiten: Die Käuferseite kann aber auf ein deutlich größeres Angebot zugreifen, die Anbieter können Ihre Kapazitäten besser auslasten.
Bislang kommt das Konzept des digitalen Marktplatzes insbesondere bei relativ einfachen oder zumindest einfach zu standardisierenden Leistungen zum Einsatz. Zwar unterscheiden sich Ferienwohnungen voneinander, doch lassen sich diese Unterschiede durch eine Beschreibung, Bilder und Karten in einer Webanwendung darstellen. Doch selbst komplexe oder kreative Dienstleistungen sind immer öfter Gegenstand digitaler Marktplätze: Angebote wie 99designs ermöglichen die Erstellung grafischer Elemente per Wettbewerb. Plattformen wie Upwork ermöglichen die Auslagerung von Tätigkeiten jedweder Art über das Internet. Insbesondere digitale Dienstleistungen wie Webdesign, Softwareentwicklung oder Übersetzungen lassen sich damit effizient anbieten und einkaufen.
Digitale Marktplätze sind für verschiedenste Güter und Dienstleistungen nutzbar. Täglich entstehen neue Angebote mit dem Ziel, das Internet für den Handel von Leistungen zu nutzen. In Anbetracht mittlerweile zahlloser Beispiele tritt die Frage in den Vordergrund, auf welche Leistungen digitale Marktplätze noch übertragbar sind. Da die bekannten Vorbilder erfolgreich agieren, indem sie einen Mehrwert Mehrwert für die Marktteilnehmer generieren, wird das Konzept auf immer weitere Bereiche übertragen. An den Beispielen Airbnb und Uber zeigt sich, dass zumindest die Investoren diese Geschäftsmodelle mit Milliardenbeträgen bewerten.
1.2 Entwicklung von Geschäftsmodellen
Gleichzeitig erlebt die Öffentlichkeit zwei Diskussionen: Zum einen stören sich viele an neuen Geschäftsmodellen. Beide genannten Beispiele werden durch Politik und etablierte Wirtschaft heftig kritisiert. Gerichte verbieten Geschäftsmodelle aufgrund von Verstößen gegen Gesetze, die nach Meinung von Beobachtern in vielen Fällen nur noch dem Schutz der etablierten Marktteilnehmer dienen. Bestes Beispiel sind dabei das Taxigewerbe und die Hotelbranche, welche beide durch massive Lobbyarbeit ihre Branchen durch Protektionismus zu schützen vermögen. Gleichzeitig fordern Wirtschaft, Wissenschaft und Politik die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle als Motor für Innovation und Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit.
Auch etablierte produzierende Industrieunternehmen können mit neuen Geschäftsmodellen ihr Angebot über die reine Produktion von Gütern hinaus ausbauen. Insbesondere mittlere Unternehmen sind für innovative Geschäftsmodelle geeignet: Sie besitzen noch nicht die behördenähnlichen Prozesse der Großkonzerne.
Wichtig zu unterscheiden ist der Unterschied von inkrementellen Verbesserungen an bestehenden Produkten im Gegensatz zur Entwicklung gänzlich neuer Geschäftsmodelle. Bei letzteren verändert sich die Position der Wertschöpfung. Das Produkt muss sich dabei gar nicht mal verändern.
1.3 IT-Dienstleistungen
IT-Dienstleistungen finden sich in jedem Unternehmen. Heutzutage ist die IT in Unternehmen so komplex, dass sich diese ausschließlich mit internen Ressourcen kaum bewerkstelligen lässt. Insbesondere Implementierungsprojekte wie die Einführung von Unternehmenssoftware oder die Pflege komplexer Infrastrukturen ist oftmals wirtschaftlicher und gleichzeitig qualitativ hochwertig durch externe IT-Dienstleister zu erbringen.
Der externe Einkauf von IT-Dienstleistungen ist dabei relativ komplex. Grundsätzlich kann man zwischen Implementierungsprojekten und Managed-Services unterscheiden. Letztgenannte werden oftmals auch als klassisches IT-Outsourcing bezeichnet. Es handelt sich um IT-Services, welche externe Dienstleister für den Auftraggeber betreiben. Darunter fallen sowohl Anwendungssysteme, als auch IT-Infrastruktur.
Anwendungen werden weltweit zunehmend durch Cloud-Dienste ersetzt (Software-as-a-Service, SaaS) oder zumindest in die Cloud verlagert (Infrastructure-as-a-Service, IaaS). Insbesondere bei komplexen ERP-Systemen muss jedoch die Anwendung weiterhin gepflegt werden, wenngleich die Hardware bei einem Cloud-Anbieter steht.
Die IT-Infrastruktur, beispielsweise Rechenzentren, Netzwerke, Desktops und zunehmend auch Mobilgeräte, ist durch eine zunehmende Standardisierung geprägt. Zudem sind immer mehr Systeme, beispielsweise Netzwerke (Software-defined networking) oder Telefonanlagen (Unified Communications), als Software implementiert. Dabei handelt es sich um Commodities, die zahlreiche Unternehmen in einer ähnlichen Konfiguration betreiben.
Implementierungsprojekte dienen der Einführung von IT-Systemen, sowohl Anwendungen, als auch IT-Infrastruktur. Dabei übernimmt ein externer IT-Dienstleister die initiale Konfiguration und bei Standardsoftware das sogenannte Customizing, also die Anpassung an die spezifischen Begebenheiten des Anwenderunternehmens. Der spätere laufende Betrieb dieser IT-Systeme erfolgt entweder intern durch die eigene IT-Organisation oder als Managed-Service durch einen externen IT-Dienstleister.
Je nach Größe des Anwenderunternehmens betreut ein einzelner IT-Dienstleister alle Systeme oder es sind mehrere IT-Dienstleister im Einsatz. Das sogenannte Provider-Management beschäftigt sich mit Ausschreibung, Vergleich und Auswahl passender IT-Dienstleistungen und die Pflege der Beziehungen zu den IT-Dienstleistern.
1.4 Beobachtungen
Ausschlaggebend für diese Arbeit sind die persönlichen Beobachtungen des Autors. Im Rahmen verschiedener Tätigkeiten ergibt sich ein Einblick in die Vorgehensweisen bei der Erbringung von IT-Dienstleistungen:
- Standardisierung: Die IT-Infrastruktur besteht heutzutage aus hochstandardisierten Leistungen, welche zahlreiche Anwenderunternehmen auf vergleichbare Weise erbringen oder durch IT-Dienstleister erbringen lassen. Dem entgegengesetzt zeigt sich in der Realität, dass die meisten Managed-Services immer noch als individuelle Lösungen mit maximaler Konfigurierbarkeit verkauft werden. Zwar wird vereinzelt zu Marketingzwecken auf eine Modularisierung hingearbeitet, jedoch ist diese bei besonderen Wünschen schnell vergessen. Ähnlich verhält es sich mit der Einführung bestimmter Anwendungssysteme, insbesondere im Bereich der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware.
- Automatisierung: Die Zeiten, in denen die Verteilung und Konfiguration von Desktops und Notebooks per Hand erfolgt, sollten eigentlich lange vorbei sein. Doch mitnichten: Selbst der eingangs beschriebene Rollout von Betriebssystemen und Anwendungssoftware geschieht in vielen Fällen immer noch in hohem Maße manuell. Selbst in sehr großen Unternehmen ist das Systemmanagement zu weiten Teilen nicht so automatisiert, wie es technisch und betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre. Auch Tätigkeiten wie das Netzwerkmanagement oder die Einrichtung von Servern gehen in vielen Fällen immer noch händisch vonstatten. Dabei sind Lösungen für eine weit(er)gehende Automatisierung seit Jahren marktverfügbar.
- Ausschreibungs- und Angebotsprozess: Auf Basis der fehlenden Standardisierung und Automatisierung erfolgt auch der Ausschreibungs- und Angebotsprozess immer noch manuell: Jedes noch so kleine Unternehmen definiert für sich neu, welche Leistungen es benötigt. IT-Dienstleister erstellen auf dieser Grundlage spezifische Angebote für individuelle Leistungen. In vielen Fällen geschieht die Berechnung der Leistungen noch auf der Basis des benötigten Zeitbedarfs, weil andere Metriken nicht vorhanden sind. Dieser Prozess ist für beide Seiten kompliziert, was im Umkehrschluss hohe Transaktionskosten mit sich bringt. Anstatt sich auf die Transformation des Unternehmens zu konzentrieren, verhandeln IT-Leiter stattdessen um Standardleistungen, wie sie bereits tausendfach anderswo erbracht werden.
- Einsatz neuer Technologien: Seit nunmehr einigen Jahren hat die Unterhaltungselektronik für Konsumenten die IT in Unternehmen als Fortschrittstreiber abgelöst. (Vor dem Jahr 2000 war dies noch andersherum). Dennoch bleibt die IT in Unternehmens in vielen Fällen hinter dem Machbaren zurück. Cloud-Lösungen vereinfachen den Aufwand der Administration zwar erheblich. Doch forcieren nur wenige Unternehmen die generelle Migration auf Cloud-Architekturen. Viele IT-Verantwortliche beschäftigen sich mit Altsystemen anstatt Informationstechnologie als werttreibenden Produktbestandteil zu nutzen.
- Geschäftsmodell: Zwar wird seit einiger Zeit seitens der IT-Dienstleister die sogenannte IT-Fabrik propagiert, im Geschäftsmodell spiegelt sich das aber bislang nicht wieder. Vielmehr besteht das mittelfristige Ziel immer noch darin, das eigene Personal auszulasten. Im Zusammenhang mit der oben beschriebenen ausbleibenden Automatisierung ist das eigene Geschäftsmodell so weiterhin nur linear skalierbar. Im Falle von Beratungs- und Implementierungsprojekten mag dies weiterhin sinnvoll sein. Im Bereich der Managed-Services ließen sich jedoch mit dem Einsatz neuer Technologien erhebliche Skaleneffekte heben. Die Motivation zum Umbau zu einer hochautomatisierten und -standardisierten IT-Fabrik ist jedoch oftmals nicht gewünscht. Das Ziel bleibt die Auslastung des eigenen Personals, anstatt IT-Dienstleistungen wirklich effizient anzubieten.
- Kenntnisstand der Anwenderunternehmen: Fraglich bleibt die Haltung der Anwenderunternehmen. Diese könnten jeweils durch eigenes Engagement zu einem Wandel beitragen. Jedoch stehen dem verschiedene Barrieren im Weg: Zum einen sind viele Anwender bereits zufrieden gestellt, wenn die IT überhaupt läuft. Anstatt die IT als Motor für Innovationen zu nutzen, verharren viele nach dem bekannten Grundsatz If it ain’t broken, don’t fix it. Die fehlende Standardisierung und Vergleichbarkeit von IT-Dienstleistungen führt zu dem Eindruck, es handele sich weiterhin um individuelle Leistungen. Viele leitende IT-Mitarbeiter sind zudem zu sehr mit dem Tagesgeschäft beschäftigt, anstatt Trends zu adoptieren und die IT-Organisation grundsätzlich zu transformieren.
- Markt: Tausende Unternehmen bieten IT-Dienstleitungen an. Die Konsolidierung schreitet nur langsam voran. Interessant sind an dieser Stelle jedoch zwei Beobachtungen: Junge Anwenderunternehmen setzen in Hohem Maße auf Cloud-Lösungen. Zwar bleiben klassische Leistungen weiterhin für viele Unternehmen relevant. In Kombination mit dem Einzug der sogenannten Digital natives ist aber in den nächsten Jahren mit einem Wandel zu rechnen. Damit verschärft sich der Wettbewerb für klassische IT-Dienstleistungen weiter. Die oftmals jetzt schon unbefriedigende Umsatzrendite soll mit der Fokussierung auf wertschöpfende IT-Themen wie Data-Analytics aufgefangen werden. Es bleibt abzuwarten, ob dies gelingen kann.
- Differenzierung und Fokussierung: Weiterhin auffällig ist eine fehlende Differenzierung des Angebots oder Fokussierung auf einzelne Branchen seitens der IT-Dienstleister. Noch am häufigsten anzutreffen sind beide im Bereich bestimmter Branchenlösungen. Doch viele IT-Dienstleister bieten weiterhin ein vollumfängliches Portfolio an Leistungen an. Nach gängigen Modellen des strategischen Managements handelt es sich hierbei jeweils um ein stuck in the middle.
Zusammenfassend findet man einen für beide Seiten vergleichsweise ineffizienten Markt vor: Teure Leistungen führen zu geringen Renditen. Dabei sind Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie wie in kaum einem anderen Bereich standardisierbar. Erkennbar ist dies auch an den zahlreichen IT-Management.-Frameworks, die Best-Practices für den Betrieb von IT liefern und diese automatisieren soll.
Diese Arbeit entwickelt ein Konzept, den Markt für IT-Dienstleistungen einfacher und transparenter zu gestalten.
1.5 Fragestellung
Zahlreiche Online-Marktplätze bilden verschiedenste Märkte im Internet ab. Diese Arbeit untersucht, ob das Konzept des digitalen Marktplatzes auf den Bereich der IT-Dienstleistungen für Unternehmen übertragbar ist.
Konkret sind drei Fragestellungen zu untersuchen:
- Wie gestaltet sich derzeit der Einkaufsprozess von IT-Dienstleistungen und wie könnte dieser Prozess verbessert werden?
- Wie könnte ein digitaler Marktplatz für IT-Dienstleistungen konkret ausgestaltet sein und welches Geschäftsmodell wäre adäquat?
- Wie könnte eine Webanwendung dafür konkret gestaltet sein?
Aus diesen Fragestellungen leiten sich drei Forschungsziele ab:
- Skizzierung aktueller Herausforderungen des Einkaufsprozesses von IT-.Dienstleistungen aus Sicht der Anwenderunternehmen und Entwicklung von Elementen zur Vereinfachung.
- Ausgestaltung eines Webangebots unter Berücksichtigung eines Geschäftsmodells zur Vermittlung von IT-Dienstleistungen.
- Implementierung des Konzepts als Prototyp in Form einer Webanwendung
Die drei Forschungsziele sind dabei unterschiedlich gewichtet: Der Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung der Herausforderungen und der Ausgestaltung des Geschäftsmodells. Die prototypische Implementierung zeigt nur einen ersten Ansatz auf.
1.6 Vorgehensweise
Diese Arbeit basiert grundlegend auf einer ontologischen Sichtweise. Sie soll die aktuelle Situation und eine mögliche Verbesserung realistisch beschreiben. Dabei bleibt trotz der eingangs erwähnten Beobachtungen ein Abstand zu den untersuchten Objekten gewahrt. Sie fußt auf einer pragmatischen Haltung gegenüber dem Untersuchungsobjekt und dessen Umwelt. Insbesondere sollen ein Verständnis für die Interaktion zwischen den beteiligten Unternehmen entwickelt werden.
Der Forschungsansatz ist induktiver Natur: Zwar besteht mit den zuvor dargestellten Beobachtungen eine Grundlage, diese dienen jedoch nur als abstrakte Hinweise auf die bestehende Problematik. Im ersten Schritt soll eine Feststellung aktueller Herausforderungen erfolgen, im zweiten ein Vorschlag zur Lösung der zuvor festgestellten Probleme. Beide Themengebiete, IT-Dienstleistungen und elektronische Marktplätze, werden in der wissenschaftlichen Literatur behandelt. Insbesondere letztere sind häufiger auch Gegenstand konzeptioneller Aufsätze.
Strategische Grundlage der Vorgehensweise ist die der Ansatz der Handlungsforschung: Für eine bestehende Problematik, hier die zuvor dargestellten Marktineffizienzen, erfolgt die Suche und Darstellung einer konkreten Lösung. Der Prototyp in Form einer Webanwendung zeigt dabei einen ersten Ansatz zur Implementierung auf. Im Vergleich zu einem rein empirischen Ansatz in Form einer Umfrage oder der Darstellung von Fallstudien spielt die persönliche Erfahrung des Autors eine wesentliche Rolle. Sie dient der Einordnung der qualitativen Feldforschung in die Marktsituation. Beide bilden die Grundlage des Geschäftsmodells und der daraus abgeleiteten prototypischen Implementierung. Insgesamt handelt es sich demnach um einen Ansatz, der vor allem praktisch relevant ist: Über die IT-Branche hinaus wird dargestellt, wie digitale Marktplätze auch komplexe Güter und Dienstleistungen vereinfachen können.
Empirische Grundlage ist eine qualitative Befragung von IT-Leitern von Anwenderunternehmen. Sie soll die Herausforderungen im Einkauf von IT-Dienstleistungen darstellen und einen Vorschlag zur Abhilfe evaluieren. Einzelne quantitative Elemente ermöglichen eine Vergleichbarkeit der Unternehmen und Einordnung der Antworten.
Der Zeithorizont ist ein Querschnitt zu einem festen Zeitpunkt. (Die empirische Erhebung über drei Monate ist bei der gewählten Fragestellung ein kurzweiliger Zeitraum.) Sowohl die Problematik, als auch der Lösungsansatz sind getrennt voneinander seit vielen Jahren bekannt. Neu ist die Kombination von Problem, Branche und Lösungsansatz. Die in dieser Arbeit durchgeführte Feldforschung zeigt auch auf, weshalb sich bisherige Ansätze bislang nicht durchsetzen konnten.
Die konkrete Vorgehensweise teilt sich analog zur Fragestellung in drei Teile. Jedes dieser Kapitel ist von verschiedenen Techniken der wissenschaftlichen Forschung geprägt.
- Eine Befragung von Unternehmen in Form von Telefoninterviews soll deren Probleme im Einkauf von IT-Dienstleistungen ermitteln. Dazu werden diese zur genauen Vorgehensweise beim Einkauf und der aus Ihrer Sicht auftretenden Herausforderungen befragt. Auf der Grundlage dieser Telefoninterviews gilt es ein grobes Konzepts zur Vermittlung von IT-Dienstleistungen auszuarbeiten. Dieses Konzept wird in einer zweiten Runde von Telefoninterviews evaluiert: Nach Vorstellung der einzelnen Bestandteile geben die Interviewpartner Anregungen zur genaueren Ausgestaltung.
- Im zweiten Schritt erfolgt die genaue Ausarbeitung und Darstellung des Angebots auf Basis der durchgeführten Telefoninterviews. Zudem spielen dabei bekannte Konzepte von Online-Marktplätzen und die Branchenkenntnisse des Autors eine wichtige Rolle. Nur die Kombination bekannter Angebote, branchenspezifisches Wissen und die Bedürfnisse der potenziellen Nutzer ermöglichen die Ausarbeitung eines adäquaten Konzepts.
- Der dritte Teil ist die praktische Implementierung des zuvor erstellen Konzepts. Diese erfolgt in Form einer Webanwendung. Sie ist ein Technologiedemonstrator, der die grundlegenden Funktionen abbildet. Der besondere Schwerpunkt liegt auf der Abbildung des Konzepts und nicht auf sekundären Eigenschaften, wie beispielsweise dem Design.
Die Arbeit stellt neben dem ausgearbeiteten Konzept und der Webanwendung auch die Erarbeitung dessen und die ermittelten Bedürfnisse der Anwenderunternehmen dar. Damit erhält der Leser einen Einblick in die Evolution von der Idee über das Konzept bis zur Implementierung.
1.7 Zugrundeliegende Frameworks
Basis dieser Arbeit sind mehrere Rahmenwerke (englisch Framework) verschiedener Autoren. Ziel dieser Frameworks ist jeweils eine Systematik zu erstellen, wie sich Innovationen und Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Die meisten der nachfolgenden Werke basieren auf einer langjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit der Autoren. Anhand zahlreicher einzelner wissenschaftlicher Aufsätze lässt sich die Entwicklung der Frameworks nachvollziehen.
Im Wesentlichen basiert diese Arbeit auf folgenden Frameworks:
- Christensen (2011) beschreibt in seinem Hauptwerk, warum zahlreiche Unternehmen trotz innovativer Ideen dennoch scheitern. Grund für das beobachtete Verhalten ist die Fokussierung auf die bestehenden Kunden und deren Bedürfnisse. Bei einschneidenden Entwicklungen einer Technologie versagt das klassische Vorgehen in Forschung und Entwicklung jedoch oftmals. Vorgeschlagener Ausweg ist die Ausgründung einer neuen Gesellschaft oder zumindest einer Abteilung, organisatorisch und geografisch fernab des konventionellen Unternehmens und seiner Kunden.
- Kim et al. (2015) ist der Meinung, dass der Kampf um Marktanteile in Zeiten harten Wettbewerbs und vergleichsweise einfach zu kopierender Konzepte schwierig geworden sei. Der Kampf mit Konkurrenten um dieselben Kunden ist somit kaum noch zu gewinnen. Ziel muss die Erweiterung des Marktes auf bislang unerschlossene Gebiete und Themen sein.
- Osterwalder et al. (2010) hat mit diesem Buch eine Referenz in der Entwicklung von Geschäftsmodellen geschaffen. Es beinhaltet ein Framework, wie ein Geschäftsmodell entwickelt und dargestellt werden kann. Insbesondere die Darstellung und Aufteilung der einzelnen Bestandteile ist heutzutage nicht mehr wegzudenken und Grundlage der Werke mehrerer anderer Autoren.
- Blank et al. (2012) detailliert mit diesem Buch sein erstes Werk mit der Erläuterung der wesentlichen Schritte zu Beginn des Aufbaus eines Unternehmens. Insbesondere der auf die Entwicklung des Geschäftskonzepts folgende Test dessen ist elementar, um das eigene Angebot auf die Bedürfnisse der Kunden zuzuschneiden. Es baut in wesentlichen Punkten auf dem Buch von Osterwalder et al. (2010) auf.
- Nach Keely et al. (2013) sind Innovationen systematisierbar. Dies erläutern sie anhand zehn verschiedener Kategorien, anhand derer sich Innovationen kategorisieren lassen. Darüber hinaus werden verschiedene feingliedrigere Innovationsmuster vorgestellt, um bestehende Produkte konkret anzupassen.
Wenngleich die genannten Werke die bedeutendsten im Bereich der Systematisierung von Geschäftskonzepten sind, existieren zahlreiche weitere. Allen gemein ist, dass sie als Framework sogenannte Best-Practices liefern, die bei Adoption durch die geneigte Leserschaft aber in jedem Fall für die eigenen Zwecke anzupassen sind.
2 Problem und Lösungsansatz
Grundlage der Arbeit ist eine qualitative empirische Erhebung. IT-Leiter von Unternehmen geben dabei Auskunft über ihren Einkaufsprozess von IT-Dienstleistungen. Die Befragung teilt sich in zwei Runden:
- Zuerst sollen die Herausforderungen im Einkauf von IT-Dienstleistungen ermittelt werden. Ergänzend erfolgt die Vorstellung der Idee des Online- Marktplatzes für IT-Dienstleistungen, um erste Hinweise für die zweite Befragungsrunde zu erhalten.
- Ein anschließend ausgearbeitetes Grobkonzept wird den teilnehmenden IT-Leitern in einer zweiten Befragungsrunde vorgestellt. Ziel ist, Eindrücke und Hinweise zu erhalten, um das Konzept anschließend vollständig darzustellen zu können.
Die Befragung erfolgt in Form von Telefoninterviews. Vorteil dieser Form der Befragung ist die große Reichweite bei gleichzeitig relativ einfacher Handhabung. Eine telefonische Befragung ist ein Kompromiss zwischen der Anzahl der Teilnehmer und Intensität der einzelnen Interviews. Zudem ist so eine breitere Streuung hinsichtlich Geografie und Branchen möglich. Die technischen Anforderungen und aktuellen IT-Projekte von Unternehmen unterscheiden sich naturgemäß. Mit der telefonischen Befragung kann eine hinreichend hohe Anzahl an Teilnehmern berücksichtigt werden.
Eine Präsentation mittels PowerPoint unterstützt die Telefoninterviews. Sie wird dem Interviewpartner per Webfreigabe auf dem Computer-Bildschirm angezeigt. Die Präsentation dient beiden Gesprächspartnern als Leitfaden, sodass Systematik und der aktuelle Abschnitt stets präsent sind.
Wichtig ist die Gestaltung als halboffene Befragung: Die Präsentation als Gesprächsleitfaden soll Thema und Reihenfolge anzeigen. Entscheidend ist jedoch der Input des Interviewpartners. Dabei soll primär nicht auf Fragen geantwortet, sondern selbständig die Situation im eigenen Unternehmen und Anregungen zur Verbesserung erläutert werden.
2.1 Problematik
Die Befragung behandelt die aktuelle Situation im Unternehmen und den Bedarf nach Unterstützung im Einkaufsprozess von IT-Dienstleistungen. Insgesamt erfolgte eine Befragung von 34 Unternehmen aus ganz Deutschland. Diese sind in den Branchen Produktion, Handel und Dienstleistungen tätig. Andere Branchen, wie Finanzdienstleistungen und die öffentliche Verwaltung sind nicht berücksichtigt. Erstgenannte haben zu komplexe Anforderungen und benötigen oftmals maßgeschneiderte Lösungen. Letztere unterliegen einem eigenen spezifischen Ausschreibungsprozess.
Um eine Vergleichbarkeit der Unternehmen herzustellen werden einige statistische Daten erhoben. Dies sind die Anzahl der Mitarbeiter, die Anzahl der IT-Nutzer und die Anzahl der IT-Mitarbeiter. Ein Unternehmen fällt statistisch aus dem Rahmen und ist daher bei der nachfolgenden quantitativen Auswertung nicht berücksichtigt.
Zu beachten ist, dass die nachfolgend dargestellten statistischen Zusammenhänge die durchgeführte Befragung wiederspiegeln. Die Befragung ist nicht repräsentativ und lässt somit keine Rückschlüsse auf die allgemeine Situation in Unternehmen zu.
Anzahl der IT-Mitarbeiter: Im Rahmen von Benchmarkings wird regelmäßig die Leistungsfähigkeit und die Kosten der IT von Unternehmen untersucht und mit anderen Unternehmen verglichen. Eine Messzahl ist dabei die Anzahl der Mitarbeiter der IT-Organisation im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter. An dieser Stelle erfolgt der Vergleich zur Anzahl der IT-Nutzer, um Unterschiede der verschiedenen Branchen auszugleichen. Zwischen den Branchen unterscheidet sich der Anteil der Mitarbeiter, welche (keine) IT-Systeme nutzen.
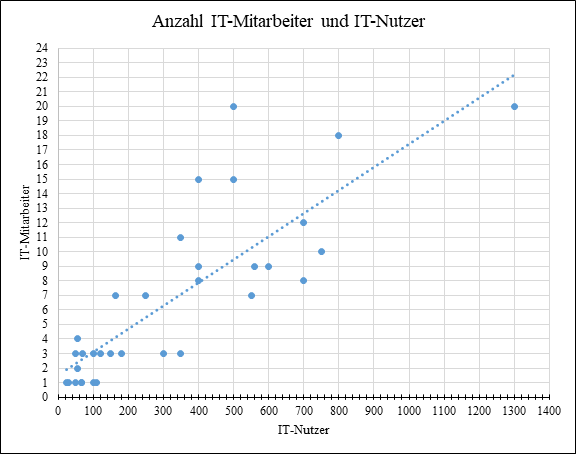
Abbildung 1: Absolute Anzahl der IT-Mitarbeiter und IT-Nutzer
Abbildung 1 zeigt die Anzahl der IT-Mitarbeiter und der IT-Nutzer in den befragten Unternehmen. Die Trendlinie veranschaulicht dabei das Verhältnis der beiden Werte. Im Durchschnitt hat ein Unternehmen 480 Mitarbeiter, 327 IT-Nutzer und sieben Mitarbeiter in der IT-Organisation. (Standardabweichungen: 439 Mitarbeiter, 294 IT-Nutzer, sechs IT-Mitarbeiter) Bezogen auf die Fragestellung stellt die Auswahl eine gute Mischung von Unternehmen unterschiedlicher Größe dar.
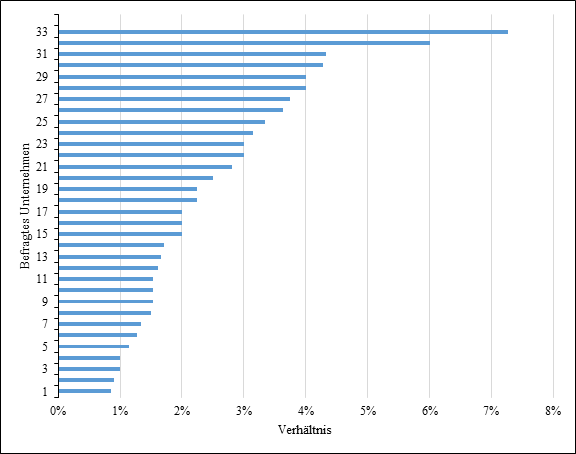
Abbildung 2: Verhältnis von IT-Mitarbeitern zu IT-Nutzern
Abbildung 2 beschreibt das relative Verhältnis zwischen der Anzahl der Mitarbeiter der IT-Organisation zur Anzahl der Anwender. Die befragten Unternehmen unterscheiden sich dabei signifikant. Der Anteil an IT-Mitarbeitern an der Gesamtzahl der IT-Anwender reicht von unter 1% bis über 7%. Wichtig: Diese Darstellung soll nur einen Überblick über die Bandbreite geben. Faktoren wie die Größe des Unternehmens, die Branche und der Anteil der eigenen IT-Organisation an der gesamten IT-Wertschöpfung sind ebenfalls wichtige Bezugspunkte.
Anteil der internen IT-Wertschöpfung: Weiterhin ist der Vergleich der Wertschöpfung der internen IT-Organisation an der gesamten IT-Wertschöpfung interessant. Sie zeigt den Grad der Auslagerung der IT an externe IT-Dienstleister und ist auch für das später dargestellte Konzept relevant: Nur wenn externe IT-Dienstleister beauftragt, können diese Aufträge auch vermittelt werden. Wenn die IT ausschließlich durch die eigene IT-Organisation erbracht wird, wäre beispielsweise ein Geschäftsmodell zur Personalvermittlung interessanter.
Mit der Wertschöpfung ist die Leistungserbringung Informationstechnologie gemeint. Dazu zählen insbesondere klassische IT-Services, aber auch einmalige Implementierungen und Migrationen. Die Interviewpartner sollen diesen Wert schätzen. In der Diskussion mit einzelnen Befragten werden aber auch erhebliche Zweifel an der korrekten Einschätzung geäußert.
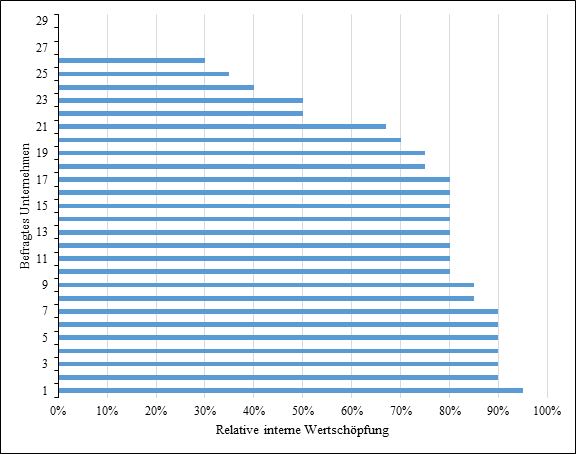
Abbildung 3: Anteil der internen Wertschöpfung an der Unternehmens-IT
Abbildung 3 zeigt den Anteil der internen Wertschöpfung an der gesamten IT-Wertschöpfung. Bei den meisten Unternehmen ist der Anteil der internen Wertschöpfung relativ hoch. Nur wenige Unternehmen lagern ihre IT vollständig aus.
Es sei angemerkt, dass bei der Kontaktaufnahme zahlreiche Unternehmen ein Telefoninterview ablehnen, da die gesamte IT ausgelagert ist. Diese Auslagerung sei von der Geschäftsführung verantwortet, welche (verständlicherweise) für ein Telefoninterview nicht zur Verfügung stünde. Ein subjektiver, aber quantitativ nicht erfasster Eindruck ist, dass kleinere Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern ihre IT in vielen Fällen vollständig einen freien IT-Mitarbeiter, seltener auch an einen IT-Dienstleister auslagern.
Suche eines IT-Dienstleisters: Wichtig für die Vereinfachung des Prozesses ist herauszufinden, wie IT-Dienstleister aktuell gefunden werden. Wenn das Anwenderunternehmen nur einen IT-Dienstleister einsetzt, finden keine projektbezogenen Ausschreibungen statt.
Anwenderunternehmen suchen für einen konkreten Auftrag auf verschiedene Art und Weise nach möglichen IT-Dienstleistern als Auftragnehmer:
- Eigenes Netzwerk: Die IT-Leiter verfügen in der Regel über Kontakte zu verschiedenen IT-Dienstleistern. Diese stammen beispielsweise aus früheren Aufträgen oder einer der nachfolgenden Punkte. Das persönliche Netzwerk ist häufig die erste Anlaufstelle bei der Recherche.
- Empfehlungen: Viele IT-Leiter vertrauen auf Empfehlungen ihnen bekannter IT-Mitarbeiter, auch aus anderen Unternehmen. Dies können Zulieferer oder Kunden, aber auch Wettbewerber oder gänzlich andere Unternehmen sein. Die Kontakte verfügen dabei über Erfahrungen mit bestimmten IT-Dienstleistern, die sie dann weiterempfehlen oder von ihnen abraten.
- Kaltakquise: IT-Dienstleister betreiben üblicherweise Kaltakquise. Dabei kann auch nur eine Kontaktmöglichkeit hinterlassen werden, auf welche dann im Bedarfsfall zurückgegriffen wird.
- Messen: Seltener genannt sind Branchen- und IT-Messen. Dabei treffen sich leitende IT-Mitarbeiter innerhalt einer Branche oder branchenübergreifend.
- Listen und Übersichten: Einige Interviewpartner nennen zudem Listen im Internet, beispielsweise IT-Dienstleister-Rankings (nach Umsatz oder Kundenzufriedenheit). Bekannte Zeitschriften für leitende IT-Mitarbeiter veröffentlichen dazu jährlich verschiedene Übersichten, welche auch als Buch erhältlich sind.
- Partnernetzwerke: Nur relativ wenige Interviewpartner nennen die Partnerseiten der Soft- und Hardwareanbieter als Einstieg in die Recherche. Dies ist verwunderlich, wo doch gerade diese Verzeichnisse zu IT-Dienstleistern mit der gewünschten Kompetenz führen. Insbesondere befragte IT-Leiter größerer Unternehmen nennen die Partnernetzwerke aber häufig als eine Möglichkeit unter mehreren. Auf Nachfrage sind vielen Befragten die Partnernetzwerke zu ungenau.
- Webrecherche: Ebenfalls häufig genannt wird die Webrecherche. Dabei erfolgt die Suche nach IT-Dienstleistern über übliche Suchmaschinen (beispielsweise Google).
- Soziale Netzwerke: Die Befragten nennen seltener soziale Netzwerke (insbesondere XING) als Kontaktform. Vorteil dieses Wegs ist die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme zu einem konkreten Ansprechpartner, wenn noch kein Kontakt zu dem IT-Dienstleister besteht.
Zusammengefasst erfolgt die Recherche auf unterschiedlichste Art und Weise. Interessant ist, dass in der Regel mehrere Ansätze gewählt werden. Der Prozess der Recherche verläuft dabei weitaus ungeordneter, als im Vorhinein angenommen.
Zu beachten ist der Sachverhalt, dass Softwareanbieter und IT-Dienstleister (Partner zur Einführung der Software) nicht immer zwei verschiedene Unternehmen sind. Insbesondere kleinere Softwarelösungen werden von demselben Unternehmen entwickelt, vertrieben und implementiert. In diesem Fall besteht auch nur ein Ansprechpartner für die gesamte Wertkette (englisch Value Chain) der Software zur Verfügung.
Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines IT-Dienstleisters sind die geografische Nähe zum Auftraggeber, die Größe des Auftragnehmers und passende Referenzen im Hinblick auf Kundengröße, -branche und Lösungskompetenz.
Aktuelle IT-Projekte: Beispiele stellen die Bandbreite und aktuelle Themenschwerpunkte bei IT-Projekten dar. Häufigste Nennungen sind die Erneuerung der Telefonanlage (beziehungsweise die Einführung einer Lösung für Unified Communications) und die Einführung einer Softwarelösung für das Dokumentenmanagement (neuerdings auch Enterprise Content Management oder Enterprise Information Management genannt). Darüber hinaus ergibt sich eine breite Palette üblicher Projekte.
Interessant sind dabei aber zwei Aspekte:
- Die überwiegende Anzahl der IT-Leiter nennt Commodities als aktuelle Projekte. Diese eher als Kostenfaktor, denn als Wertbeitrag anzusehenden Lösungen und Projekte besitzen in der Regel keine strategische Relevanz. Sie werden am ehesten an IT-Dienstleister ausgelagert. Dazu zählen Standardlösungen wie ERP-Systeme oder die Erneuerung der Infrastruktur (Server, Netzwerk).
- Nur zwei Gesprächspartner nennen Industrie 4.0 und das Internet der Dinge als aktuelle Projekte. Dies ist in Anbetracht der öffentlichen Berichterstattung und der volkswirtschaftlichen Relevanz dieses Themenbereichs sehr wenig. Zumindest die befragten Unternehmen scheinen die sogenannte Digitalisierung bislang nicht aktiv voranzutreiben.
Zusammenfassend beschäftigen sich die IT-Abteilungen mit üblichen Vorhaben. Die Weiterentwicklung der internen IT vom Kostentreiber zum Partner des Geschäfts scheint sich zumindest bei den befragten Unternehmen derzeit (noch) nicht zu vollziehen.
Probleme bei IT-Projekten: Auf die Frage nach Problemen bei IT-Projekten sind die häufigsten Antworten als klassische Managementprobleme einzuordnen. Interessanterweise zählen Probleme mit dem IT-Dienstleister zu den eher seltener genannten Herausforderungen, wenngleich es dann auch zum Abbruch des Projekts und dem Austausch des Dienstleisters kommen kann. Häufig genannt sind darüber hinaus Probleme in der Abstimmung zwischen Business und IT. Insbesondere Verständigungsprobleme und Änderungen der Anforderungen führen hier mitunter zum Abbruch von Projekten oder zumindest zu deren Verzögerung. Ressourcenmangel als Ursache für Probleme wäre ein Grund, mehr Leistungen an externe IT-Dienstleister auszulagern.
Unterstützung des IT-Einkaufs: Externe Unterstützung zur Unterstützung des Einkaufs von IT holen sich nur wenige Unternehmen. Häufigste genannte Unterstützung sind provisionsgetriebene Softwarevergleiche, insbesondere in den Bereichen Enterprise-Ressource-Planning und Dokumentenmanagement. Bei diesen Angeboten füllt der Auftraggeber einen Fragebogen aus, woraufhin der Vertriebskontakt zu passenden Anbietern von Softwarelösungen hergestellt wird. Dies sind oftmals Anbieter, die wie oben dargestellt die Implementierung selber durchführen und daher über kein Partnernetzwerk verfügen. Dazu kommen Anbieter von Erweiterungen (Add-on; Plug-in) gängiger ERP-Systeme. Diese Partner der ERP-Anbieter verkaufen dann die Implementierung der Lösung mitsamt ihrer eigenen Erweiterung. Hier verwischt die Trennung zwischen Softwareanbieter und IT-Dienstleister dann noch stärker.
Darüber hinaus erfolgt beim Einkauf von IT-Systemen nur selten eine Unterstützung durch Dritte. Häufigstes genanntes Projekt dafür ist die Erneuerung der Telefonanlage beziehungsweise der Einführung einer Lösung für Unified-Communications. Dabei unterstützt der sogenannte Auswahlberater bei der Auswahl der passenden Lösungen mit seinem Wissen, einem methodischem Framework und Best-Practices zur Vorgehensweise. Größere Unternehmen lassen sich durch spezialisierte Unternehmensberatungen im sogenannten IT-Sourcing (Einkauf) beraten. Dies erfolgt regelmäßig ab einem Auftragsvolumen von zehn Millionen Euro, in kleinerer Form aber manchmal auch ab einer Million Euro.
Vereinfachung des IT-Einkaufsprozesses: Viele Befragte haben keine eigenen Anregungen für eine Vereinfachung des Einkaufsprozesses von IT. Auf der anderen Seite können sich einige Befragte durchaus verschiedene unterstützende Maßnahmen vorstellen und sind bei der Darstellung durchaus kreativ.
Generell lässt sich der Wunsch nach Unterstützung im IT-Einkaufsprozess auf verschiedene Punkte herunterbrechen:
- Produktvergleiche: Viele Befragte beklagen das Fehlen systematischer Vergleiche von Soft- und Hardwarelösungen. Einzukaufende Vergleiche (beispielsweise von Gartner) sind zu oberflächlich. Hier gehen die Meinungen aber weit auseinander. Bisweilen wird sogar der Feature-Vergleich in Form einer Stiftung Warentest für Software gewünscht. Die Alternative ist der Einkauf von Beratungsleistungen, die aber nur wenige Unternehmen in Anspruch nehmen. Letztendlich bleiben so nur die Webrecherche zu verschiedenen Produkten und der eigene Vergleich.
- Dokumentvorlagen: Einige Befragte vermissen darüber hinaus Vorlagen zu Ausschreibungen und Verträgen. Diese Dokumente seien entweder nur durch die IT-Dienstleister zu erhalten oder selber zu erstellen. Das ist auch der Grund, warum zahlreiche Unternehmen auf einen systematischen Ausschreibungsprozess verzichten. Auch wenn sich durch diesen im Zweifelsfall bessere und günstigere Leistungen einkaufen ließen, ist er zu komplex in der Handhabung. Best-Practices könnten hier den Prozess deutlich vereinfachen, indem nur noch eigene Besonderheiten ergänzt werden.
- Anbieterverzeichnis: Obwohl nur wenige Interviewpartner die Partnernetzwerke der Hard- und Softwareanbieter nutzen, wird öfters der Wunsch nach einem zentralen Verzeichnis von Anbietern mitsamt des jeweiligen Leistungsspektrums genannt.
- Systematisierung: Der Vorschlag zur Formalisierung des Einkaufsprozesses kommt nur vereinzelt. Eine Möglichkeit ist hierbei die Abwicklung des Ausschreibungsprozesses über eine Webanwendung. Diese Form der Interaktion mit Zulieferern ist bei den erwähnenden Personen bereits von Supplier-Management-Systemen aus Industrie und Logistik bekannt. Diese Systeme funktionieren in der Regel unternehmensspeifisch und sind beispielsweise als ERP-Erweiterung (beispielsweise SAP SRM) oder Cloud-Lösung (beispielsweise SAP Ariba oder SupplyOn) erhältlich.
- Externe Unterstützung: Seltener besteht der explizite Wunsch nach aktiver Unterstützung im Einkaufsprozess durch Beratungsleistungen. In diesen Fällen ist Beratung bei der Provider-Auswahl und den Vertragsverhandlungen gewünscht. Dies betrifft sowohl kaufmännische, als auch technische Fragestellungen. Im Unterschied zu den angebotenen Leistungen durch auf das IT-Sourcing spezialisierte Unternehmensberatungen sollte dieses Angebot auch für Unternehmen mit weniger als 1000 Mitarbeitern zugänglich sein. Zudem sollte die Preisgestaltung transparenter und mit Projektumfang skalierend sein.
- Provider-Management: Darüber hinaus besteht, wenn auch seltener, der Bedarf nach Unterstützung im Provider-Management. Im Vergleich zum vorherigen Punkt bezieht sich diese Leistung auf den laufenden Betrieb und nicht die Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit dem IT-Dienstleister. Die Forderungen sind aber ähnlich: Angebote für Unternehmen unterschiedlicher Größe und ein einfaches Abrechnungsmodell.
Für den Autor ist insbesondere die Erkenntnis neu, dass den Unternehmen Unterlagen zum Vergleich von Lösungen und zur Vorbereitung von Ausschreibungen fehlen. Darüber hinaus steht die geringe Nutzung der Partnernetzwerke im Kontrast zur Forderung nach einem Branchenbuch der IT-Dienstleister.
Thesen zu Herausforderungen: Um die vorgenannten Punkte aufzugreifen und weiteren Diskussionsinput zu erhalten, werden drei Thesen zu Herausforderungen im Einkauf von IT-Dienstleistungen vorgestellt.
Diese Thesen sollen im Anschluss als Diskussionsgrundlage dienen:
- Der Markt für IT-Dienstleistungen ist relativ intransparent.
- Unternehmen fällt es schwer Anforderungen zu definieren und den Ausschreibungsprozess systematisch vorzunehmen.
- Die tatsächliche Kompetenz eines Anbieters zu prüfen ist schwierig.
Den drei Thesen wird mehrheitlich zugestimmt, wobei die Anmerkungen durchaus verschieden sind. Es erfolgen verschiedene Hinweise zu den einzelnen Punkten:
- Der Überblick über IT-Dienstleister und deren Portfolio fällt schwer. Zum einen existiere kein übergreifendes Branchenverzeichnis. Die hohe Anzahl der IT-Dienstleister einzugrenzen ist somit erschwert. Der Prozess ist im Allgemeinen beherrschbar, aber langwierig. Da die Frage des Öfteren fälschlicherweise nicht nur auf Dienstleistungen bezogen wird, beschreiben viele die Komplexität der Auswahl von Softwarelösungen. Hier wünschen sich viele Befragte mehr zentralisierte Informationen zu Anbietern und Lösungen. Bestehende Informationsangebote seien entweder zu weit verstreut und müssten erst recherchiert werden oder sind nur kostenpflichtig zu erhalten. Insgesamt betrachten viele Befragte das Angebot für den Vergleich von Softwarelösungen und IT-Dienstleistern als verbesserungswürdig.
- Bei der Anforderungsdefinition teilen sich die Befragten in zwei Lager: Entweder es erfolgt gar keine Ausschreibung. In diesem Fall geht man auf einzelne IT-Dienstleister zu, bespricht den Bedarf und geht mit einem Angebot auf die Wettbewerber zu. Von IT-Leitern, die tatsächlich zumindest ansatzweise einen systematischen Ausschreibungsprozess nutzen, bejahen die meisten die These des komplexen Prozesses. Für einzelne Befragte ist die Definition der eigenen Anforderungen so schwierig, dass überwiegend auf die Vergabe verzichtet und die IT somit praktisch vollständig intern erbracht wird.
- IT-Dienstleister zu vergleichen fällt vielen Befragten schwer. Dies hat hauptsächlich zwei Gründe: Zum einen ist der Umgang mit Kunden- und Projektreferenzen schwierig. Diese sind entweder nicht ausreichend vorhanden oder passen nicht zu den eigenen Anforderungen. Letzteres insbesondere aufgrund einer anderen Unternehmensgröße, anderer Branche oder anderer eingesetzter Technologien. Vielen fällt zudem die Prüfung er Referenzen schwierig. Nur einzelne Befragte äußerten die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu den Referenzen. Der zweite Grund ist sehr interessant, wenngleich seltener genannt: Die mangelnde Vergleichbarkeit der Leistungen. Dies liegt nach Meinung der Befragten nicht an den Leistungen selber, sondern an einer gewollten künstlichen Individualisierung der Leistungen. Zwar kochen alle nur mit Wasser, doch wird eine Abgrenzung zum Wettbewerb künstlich erzeugt.
Zusammenfassend finden die drei Thesen überwiegend Bestätigung. Entscheidend ist jedoch vor allem der qualitative Input beim Übergang zur nächsten Fragestellung.
Vision eines digitalen IT-Marktplatzes: Abschließend erfolgt eine grobe Skizzierung eines digitalen IT-Marktplatzes auf Basis der Muster bekannter Online-Marktplätze. Die Befragten sollen einschätzen, ob ein solches Konzept vorstellbar ist und ihre Arbeit vereinfachen könnte. Zudem sollen die Interviewpartner Vorschläge zur konkreten Umsetzung einbringen.
Wenngleich bei den vorherigen Fragen teilweise eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, erfolgt fast immer eine Aussage zu dem vorgestellten Konzept. Grundsätzlich ist das Feedback zu der Idee positiv, vereinzelt werden aber Zweifel an der Umsetzbarkeit geäußert.
Einige Aspekte stechen heraus:
- Viele Befragte loben die Möglichkeit einer möglichen Vereinfachung des Einkaufsprozesses. Insbesondere wenn vergleichbare Konzepte für Konsumenten bekannt sind, lassen sich Vorteile erkennen. Der verstärkte Wettbewerb käme den Anwenderunternehmen zugute und ließe sie die Kosten verringern.
- Insbesondere Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern erbringen einen Großteil der IT-Leistungen selber oder besitzen einen einzelnen IT-Dienstleiser oder freien IT-Mitarbeiter für alle Leistungen. Folglich haben diese Unternehmen dann auch nur einen sehr begrenzten Bedarf, Leistungen über eine Plattform auszuschreiben. Wenn diese Unternehmen Leistungen extern vergeben, erfolgt dies regelmäßig nicht im Rahmen einer systematischen Ausschreibung, sondern in Kooperation mit dem bestehenden IT-Dienstleister.
- Teilweise besteht der Wunsch nach standardisierten Leistungspaketen, welche gängige Leistungen zusammenfassen sollen. Da viele Leistungen regelmäßig bei vielen Unternehmen erbracht werden, könnte ein geführter Dialog mit Vorlagen den Prozess weiter vereinfachen. Allgemein ist nach Ansicht der IT-Leiter die Anfertigung der Architekturen und Leistungsbeschreibungen der weitaus kompliziertere Teil, als diese Dokumente im Rahmen einer Ausschreibung an verschiedene IT-Dienstleister zu verteilen.
- Sehr häufig wird sich zu Referenzen und deren Nutzen geäußert. Eine Ausschreibungsplattform sollte ein Reputationsmanagement enthalten. Entweder die Referenzen wären im Vorhinein einsehbar oder würden mit dem Vorschlag zur Umsetzung des Projekts mitgesendet werden. Wichtig ist vielen auch die passgenaue Auswahl von Referenzen: Hier scheinen die IT-Dienstleister bislang nicht den Forderungen der potenziellen Kunden entgegenzukommen. Referenzen von DAX-Unternehmen helfen mittelständischen Unternehmen nicht weiter oder sind sogar kontraproduktiv. In jedem Fall präsentieren sich die IT-Dienstleister zu selten zielgruppengerecht. Zudem sollten Referenzen zu kontaktieren sein. Der Projektmanager oder IT-Leiter der Referenz sollte in einem telefonischen Gespräch von seinen persönlichen Eindrücken erzählen.
- Eine Ausschreibungsplattform käme für viele befragte IT-Leiter für größere Aufträge in Betracht. Insbesondere die vorausgehende Arbeit in Form der Anfertigung einer Ausschreibung wird ansonsten als zu komplex betrachtet.
- Des Öfteren sind Zweifel bemerkbar: IT-Dienstleistungen seien zu komplex für die Ausschreibung über eine Online-Plattform. Der persönliche Kontakt sei relevant und der Ausschreibungsprozess zu komplex. Insbesondere Nachfragen, Erläuterungen zum Projekt und genauere Angaben erfordern Flexibilität im Einkaufsprozess. Insbesondere sei es nicht möglich, den vollständigen Transaktionsprozess über ein Webangebot abzuwickeln.
- Viele IT-Leiter könnten sich grundsätzlich vorstellen, für ein solches Webangebot zu bezahlen. Insbesondere wenn der Einkaufsprozess signifikant und messbar verbessert würde, käme auch die Inanspruchnahme eines kostenpflichtigen Angebots in Frage.
Insgesamt ist die erste Einschätzung überwiegend positiv. Einige Befragte können aber mit der Idee eines Online-Marktplatzes überhaupt nichts anfangen. Dies hat in der Regel individuelle Gründe, beispielsweise weil keinerlei externe IT-Dienstleister beauftragt werden. Diese Interviewpartner nehmen nicht an der zweiten Befragung teil. Insgesamt sollen 27 von 34 (79,4%) Interviewpartner an der zweiten evaluierenden Befragung teilnehmen.
2.2 Lösungsansatz
Auf Basis der ersten Befragung der IT-Leiter erfolgt eine Ausarbeitung eines Konzepts für einen digitalen Marktplatz für IT-Dienstleistungen. Dieses Konzept wird anschließend mit den Teilnehmern der ersten Befragung im Rahmen einer zweiten Befragung evaluiert.
Das Konzept besteht aus drei Komponenten:
- Dokumentvorlagen
- Anbieterverzeichnis
- Ausschreibungsplattform
Dokumentvorlagen: Wie oben ausgeführt zeigt sich, dass die Definition der eigenen Anforderungen für die Anwenderunternehmen eine hohe Hürde darstellt. Das IT-Management beginnt die Anfertigung eine Architektur- oder Leistungsbeschreibung regelmäßig mit einem weißen Blatt. Diese Vorgehensweise verkompliziert den Prozess so sehr, dass in der Folge viele Unternehmen weniger Leistungen ausschreiben, als eigentlich gewollt. Vielmehr werden die Maßnahmen durch eigenes Personal oder gar nicht durchgeführt. Alternativ erfolgt die Vergabe an einen IT-Dienstleister freihändig, das heißt ohne systematischen Ausschreibungsprozess. Gleichzeitig wird aber die schwierige Vergleichbarkeit der Angebote beklagt.
Abhilfe soll die Bereitstellung von Dokumentvorlagen schaffen. Diese bestehen aus IT-Architekturen zur Definition des Zielzustands (Was soll entstehen?), Leistungsbeschreibungen zur Definition der Tätigkeiten (Was soll erledigt werden?) und ergänzenden Vorlagen wie Ausschreibungen und Verträgen. Die Dokumente nehmen die Rolle des Lastenhefts ein, die IT-Dienstleister erstellen ein Pflichtenheft als Teil des Vorschlags im Rahmen des Angebotsprozesses.
Anbieterverzeichnis: Die erste Befragung zeigt, dass die Recherche nach IT-Dienstleistern von vielen Befragten als Herausforderung betrachtet wird. Zwar existieren die Partnernetzwerke der Soft- und Hardwareanbieter, doch finden diese eher seltene Beachtung. Gründe dafür sind eine fehlende systematische Vorgehensweise, ein unzureichender Informationsgehalt und schlechte Bedienbarkeit der entsprechenden Webanwendungen. So beschränken IT-Mitarbeiter ihre Recherche auf bekannte IT-Dienstleister oder suchen nur über normale Suchmaschinen nach weiteren. Dass diese Vorgehensweise deutlich langwieriger ist und nur unzureichende Ergebnisse liefert nehmen die Befragten in Kauf. Der Vergleich von IT-Dienstleistern fällt vielen Befragten schwer. Detaillierte Referenzen fehlen entweder vollständig, sind zu kurz, zu stark verallgemeinert, anonymisiert oder passen nicht in Hinblick auf Branche, Leistung oder Unternehmensgröße. Darüber hinaus weicht bei den IT-Dienstleistern die Darstellung der eigenen Kompetenzen von deren tatsächlichen Erfahrungen ab. Wenn die Kompetenz dann erst vor oder während des Projekts aufgebaut wird, kommt es schnell zu Enttäuschungen.
Ziel eines Anbieterverzeichnisses ist die strukturierte Darstellung von IT-Dienstleistern. Die Überlegenheit gegenüber der manuellen Websuche oder den Partnersuchen liegt im erhöhten Informationsangebot, der Verbindung verschiedener Informationsquellen, der redaktionellen Aufbereitung der Informationen und der Aktualität. Ausgereifte Filtermöglichkeiten nach Geografie (Standorte der Unternehmen), Kundenzielgruppe, Kompetenzen (Hard- und Software) und Branchenschwerpunkte erlauben einen schnellen Überblick über die Marktteilnehmer und ihre Fähigkeiten. Darüber hinaus listet ein Verzeichnis von Referenzen in Form von Fallstudien (englisch Case Studies) eine Auswahl durchgeführter Projekte der IT-Dienstleister. Diese sind durchsuchbar, sodass IT-Dienstleister anhand durchgeführter Referenzprojekte gefunden werden können.
Ausschreibungsplattform: Im Rahmen der ersten Interviewrunde ist erkennbar, dass viele Unternehmen ihre Ausschreibungen manuell verteilen. Eine systematische Vorgehensweise ist nur in wenigen Fällen erkennbar. Nur eine begrenzte Anzahl von Anwenderunternehmen nutzt dazu Systeme für die elektronische Beschaffung oder das Supplier-Relationship-Management. Der Prozess läuft so vergleichsweise unstrukturiert ab. Darüber hinaus führt der manuelle Prozess zu einem Mehraufwand bei der Bewältigung der Rückfragen: Der Aufwand einer Ausschreibung und dabei insbesondere die Beantwortung von Rückfragen skaliert linear zur Anzahl der Empfänger der Ausschreibung. Das hat zur Folge, dass nur wenige IT-Dienstleister an der Ausschreibung teilnehmen.
Abhilfe soll der ursprüngliche Kern des Konzepts schaffen: Eine Webanwendung zur Verteilung von Ausschreibungen. Auf dieser Plattform lässt sich die Ausschreibung hochladen und von den Empfängern einsehen. Rückfragen können über die Webanwendung beantwortet werden. Im Anschluss stellen die IT-Dienstleister einen Vorschlag zur Umsetzung (englisch Proposal) ein. Für IT-Dienstleistungen sind komplexe Beratungen und Verhandlungen notwendig, sodass der Transaktionsprozess über die Webanwendung nur eine Initialisierung darstellt. Ziel ist die Reduzierung einer langen Liste von Ausschreibungsempfängern auf eine kleine einstellige Anzahl von möglichen Vertragspartnern, mit denen weitere bilaterale Verhandlungen zu führen sind.
2.3 Evaluation des Lösungsansatzes
Die zweite Befragung dient der Evaluation, der weiteren Ausarbeitung und insbesondere auch der Entwicklung eines passenden Geschäftsmodells. Zudem soll der Markt ermittelt und die Marktpositionierung vorbereitet werden. Die Evaluation testet, ob das Konzept für die befragten IT-Leiter einen konkreten Nutzen hätte. Im nachfolgenden dritten Kapitel ist das Konzept aufbauend auf die beiden Interviewrunden vollständig dargestellt.
Grundlage der zweiten Befragung ist eine Präsentation der Ergebnisse der ersten Interviewrunde. Dabei sind in drei Abschnitten jeweils die Problematik und anschließend ein Lösungsvorschlag dargestellt. Die Befragten nehmen dazu jeweils Stellung. Neben der Bewertung des Nutzens für das eigene Unternehmen sollen insbesondere Ergänzungen in Form weiterer konzeptioneller Anregungen erfolgen.
Zur Evaluation des Ansatzes erfolgt die zweite Befragung der Interviewpartner der ersten Befragung. Insgesamt nehmen daran 19 Personen teil. Neben den sieben Befragten, welche wie oben beschrieben nicht an der zweiten Runde teilnehmen, ergibt sich eine Absage aus verschiedenen Gründen bei acht weiteren Personen. (Terminliche Engpässe ist der am häufigsten genannte Grund.) Zu beachten ist, dass ausschließlich Personen an der Befragung teilnehmen, die der Idee in der ersten Interviewrunde grundsätzlich positiv gegenüber stehen. Damit reduziert sich naturgemäß der Anteil generell kritisch eingestellter Interviewpartner. Ziel ist, qualitative Anregungen zur Anfertigung des Konzepts zu erhalten. Eine Evaluation des fertigen Konzepts ist nicht Bestandteil dieser Arbeit.
Die zweite Befragung teilt sich in zwei Abschnitte: Zuerst gilt es, die drei oben beschriebenen Elemente zu untersuchen. Diese gilt es auf Praxistauglichkeit zu prüfen und den Kundennutzen zu optimieren. Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung des Gesamtkonzepts mit allen drei Komponenten und abschließende Fragen zur eigenen Zahlungsbereitschaft.
Zusätzlich zu den Teilnehmern der ersten Runde nehmen verschiedene weitere Personen an der zweiten Befragung teil. Dies sind insbesondere leitende Mitarbeiter eines internationalen IT-Dienstleisters. Da dieser auch mittlere Anwenderunternehmen als Kunden besitzt, sind die Rückmeldungen ebenfalls relevant. Darüber hinaus fließen die Informationen dieser Gespräche in das Konzept und einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen des Konzepts ein. (Siehe dazu die beiden nachfolgenden Kapitel.)
Die Dokumentvorlagen werden von den Befragten insgesamt äußerst positiv gesehen. Insbesondere der Start eines Projekts mit einem leeren Blatt wird als anstrengend betrachtet, zumal in der Regel die Projekte in ähnlicher Form bereits in einer Vielzahl anderer Unternehmen durchgeführt worden sind. Zweifel äußern einige aufgrund der Komplexität von IT-Dienstleistungen.
Verschiedene Merkmale und Funktionalitäten sind gefordert:
- Anpassbarkeit: Bei den Dokumenten sollte es sich um anpassbare Vorlagen, anstatt fertiger Dokumente handeln. Insbesondere müssen sich eigene Ergänzungen leicht einpflegen lassen. IT-Dienstleistungen sind in gewisser Weise immer individuell, was sich auch in den Dokumentvorlagen wiederspiegeln muss.
- Umfang: Die überwiegende Anzahl der Befragten hält es für sinnvoll, möglichst umfassende Dokumente zur Verfügung zu stellen. Diese sollten auch konträre Komponenten umfassen. Mit diesem Ansatz lassen sich weniger Details vergessen, wobei überflüssige einfach gestrichen werden. Bestandteile zu löschen ist einfacher als welche zu ergänzen.
- Modularisierung: Um die Komplexität der Themen und damit auch die Dokumentvorlagen beherrschbar zu machen, sollten diese als Module kombinierbar sein. Damit wären sie relativ einfach veränderbar, wobei sich die Auswirkungen bei partiellen Änderungen im Rahmen halten.
- Einfache Bedienbarkeit: Die Erstellung eigener Dokumente auf Basis der Vorlagen sollte möglichst einfach möglich sein. Insbesondere sind ergänzende Informationen und Anleitungen bereitzustellen.
- Prozessorientierte Strukturierung: Die Anfertigung sollte prozessorientiert erfolgen. Beispiele dafür sind Assistenten und Workflows: Durch die Beantwortung von Fragen wird das Dokument mit den passenden Elementen ausgefüllt. Damit ließen sich viele Leistungen sowohl einfach, aber auch mit einem hohen Detailgrad ausschreiben.
- Ergänzende Informationen: Viele IT-Leiter haben regelmäßig mit für sie neuen Themen zu tun. Die Recherche ist in diesen Fällen oftmals aufwendig und zeitintensiv. Auch dieser Prozess sei durch die Bereitstellung von Informationen zu vereinfachen. Dazu zählen insbesondere Informationen und Übersichten über vergleichbare Lösungen verschiedener Anbieter.
- Weiterentwicklung der Dokumente: Die meisten Benutzer würden die Dokumente an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Viele Befragte sehen es als sinnvoll an, wenn die Ergänzungen der Anwenderunternehmen in die Vorlagen zurückfließen würden.
Interessant ist noch die Anmerkung eines Befragten, dass solche Dokumentvorlagen in anderen Branchen bereits existieren. Diese Vorlagen seien jedoch nicht öffentlich verfügbar, sondern gehören den Systemanbietern und lassen sich im Rahmen der Projekte nutzen. Das Beispiel spiegelt demnach die Vorgehensweise bei der Beauftragung einer Unternehmensberatung zur Unterstützung des Ausschreibungsprozesses wieder. Diese bringt bei Beauftragung ebenfalls entsprechende Dokumente mit.
An dieser Stelle sei noch mal an den normalerweise zweigeteilten Auswahlprozess hingewiesen: In der Regel wird sich zuerst für eine Lösung (Hard- und/oder Software) entschieden. Anschließend erfolgt die Suche nach einem IT-Dienstleister für die Implementierung. (Alternativ führt die interne IT-Organisation die Lösung selber ein.) Davon abweichend existieren zahlreiche kleine Softwareanbieter, die ihre Lösung ausschließlich selber einführen und nicht Dritten lizenzieren, geschweige denn über ein Partnernetzwerk verfügen.
Die Vorlagen unterstützen nicht bei der Entscheidungsfindung für einen Hard- oder Softwareanbieter oder einen IT-Dienstleister. Unterstützung bei der Entscheidungsfindung für eine Lösung oder einen IT-Dienstleister ist aber ebenfalls gewünscht. Nur vergleichsweise wenige befragte IT-Leiter greifen systematisch auf Research-Dokumente, zum Beispiel von Gartner, IDC oder Forrester, zurück. Die meisten sichten diese maximal gelegentlich.
Ein Anbieterverzeichnis von IT-Dienstleistern wird ebenfalls von allen Befragten begrüßt. Das Konzept ist einigen bereits von digitalen Branchenbüchern oder Lieferantenverzeichnissen bekannt. Darüber hinaus existieren Ansätze von Lösungsverzeichnissen für verschiedene Software, insbesondere ERP- und CRM-Systeme. Gewünscht sind gute Filtermöglichkeiten, um die hohe Anzahl von Anbietern einzugrenzen. Oftmals genannte Filter sind Kompetenzen, Geografie, Partner (Hard- und Softwareanbieter), die Größe der IT-Dienstleister (Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter), die Größe der Kunden (Anwenderunternehmen) und Branchenschwerpunkte.
Auch in der zweiten Interviewrunde ist die Auflistung von Referenzen in Form von Fallstudien ein besonders häufig gewünschtes Merkmal. Viele Befragte sehen Referenzen als einzige Möglichkeit, eine Bewertung vor der Kontaktaufnahme vorzunehmen. Dabei sollten die Referenzen möglichst detailliert sein und nicht nur aus einer Auflistung von Kunden bestehen. Im besten Fall sind sie mit Ansprechpartner versehen, sodass eine Kontaktaufnahme möglich ist. Sie sollten zudem kategorisiert sein und sich im Volltext durchsuchen lassen. Einige Befragte wünschen sich zudem Bewertungsmöglichkeiten wie bei konsumentenorientierten Online-Marktplätzen (beispielsweise Amazon Marketplace, eBay).
Einige Interviewpartner nutzen die Partnerverzeichnisse der Hard- und Softwareanbieter sporadisch. Eine regelmäßige systematische Suche nach IT-Dienstleistern erfolgt dabei durch keinen Befragten. Zwar ist die Zustimmung zum erläuterten Konzept sehr hoch, doch sind angesichts der bisherigen Nichtbeachtung bestehender Angebote gewisse Zweifel an den Aussagen angebracht.
Auch die Ausschreibungsplattform zur Verteilung von Ausschreibungen an IT-Dienstleister erfährt weitestgehend positive Resonanz. Dabei stechen einige geforderte Merkmale heraus:
- Prozess: Die Webanwendung sollte einen prozessorientierten Charakter besitzen. Analog zu den Vorlagen ist auch hier der Wunsch nach einer Führung durch den Prozess mit Hilfe eines Workflows gewünscht.
- Kommunikation und Rückfragen: Rückfragen der IT-Dienstleister zu einer Ausschreibung sollten direkt auf der Plattform beantwortet werden können. Wichtiges Merkmal ist die Entkopplung des Aufwands der Ausschreibung von der Anzahl der Empfänger der Ausschreibung (IT-Dienstleister).
- Datenschutz: Sehr häufig gefordert ist ein stringenter Schutz der Daten. Die oftmals geäußerte Befürchtung lautet, dass hochsensible Informationen zu IT-Architekturen und speziell sicherheitsrelevanter Bestandteile in die falschen Hände gerät.
- Kollaborative Funktionen: Die Nutzung sollte mit mehreren Mitarbeitern des Anwenderunternehmens möglich sein, die sich über die Plattform zudem austauschen und beispielsweise die Rückmeldungen und Vorschläge der IT-Dienstleister gemeinsam bewerten können. Teilweise ist auch gefordert, dass der Einkaufsprozess vollständig über die Plattform abgewickelt und damit gänzlich auf Drittmittel verzichtet werden kann.
Viele befragte IT-Leiter kennen das Konzept des Online-Marktplatzes aus dem privaten Bereich. Insbesondere die Mitarbeiter größerer Unternehmen kennen das Konzept zudem von Supplier-Relationship-Lösungen und vor allem Cloud-Software für die elektronische Beschaffung.
Eine abschließende gemeinsame Bewertung stellt die drei Elemente in einen direkten Zusammenhang. Alle Befragten können sich eine Nutzung des Gesamtkonzepts vorstellen. Interessant ist der Aspekt, dass die drei Elemente durchaus auch als notwenige Bestandteile gesehen werden, um als ein Angebot zu funktionieren. IT-Leiter kleinerer Unternehmen betrachten das Anbieterverzeichnis, größerer Unternehmen die Dokumentvorlagen als wichtiger. Die Ausschreibungsplattform gilt überwiegend als nette Ergänzung. Für das zu erstellende Geschäftsmodell ist aber eine Rückmeldung besonders interessant: Der Aufwand, die Ausschreibung anzufertigen und die zu adressierenden IT-Dienstleister zu recherchieren übersteigt bei weitem den Prozess der Verteilung der Ausschreibung an diese. Doch sei der Aufwand die Ausschreibungsplattform zu nutzen im besten Fall so gering, dass diese, da angeboten, ebenfalls genutzt wird.
Vereinzelt erfolgt eine Befragung zur Zahlungsbereitschaft für die einzelnen Elemente und/oder zum Gesamtkonzept. Dabei ist der Eindruck überwiegend positiv: Für die Dokumentvorlagen besteht in fast allen Fällen eine Bereitschaft, diese zu erwerben. Als reine Software betrachtet, sehen einige Befragte Vorteile in der Ausschreibungsplattform. Das Anbieterverzeichnis gehört nach überwiegender Meinung von den IT-Dienstleistern finanziert.
Öfters sind Bedenken bezüglich der Transparenz, Ehrlichkeit und Unabhängigkeit zu vernehmen. Insbesondere bei einer Finanzierung durch Werbung sollten die Zahlungsströme offengelegt, sodass nicht einzelne IT-Dienstleister bevorzugt werden. Dies gilt auch für die Dokumentvorlagen: Diese sollten insbesondere anbieter- und, soweit möglich, technologieneutral sein. Einige befragte IT-Leiter sehen direkte Gebühren als ehrlichste Form der Finanzierung, wenngleich ein Abonnement eine zu enge Bindung und zu hohe Kosten verursacht. Die Bewertung eines möglichen Angebots fällt vielen Befragten schwierig. Eine alternative Form der Finanzierung über Provisionen, wie bei bekannten konsumentenorientierten Online-Marktplätzen stößt weitestgehend auf Zustimmung, wenn dies offen und ehrlich kommuniziert würde. Einzelne Stimmen sehen diese Form der Finanzierung kritisch, da durch einen Preisaufschlag die Provisionen letztendlich durch die Auftraggeber bezahlt werden und eine direkte Finanzierung ehrlicher wäre.
3 Darstellung des Konzepts
Die beiden Interviewrunden in Kombination mit den einführenden Beobachtungen münden in nachfolgendem Konzept. Es ist in Aufbau und Struktur an die eingangs beschriebenen Frameworks angelehnt.
3.1 Problem
Unternehmen stehen vor verschiedenen Herausforderungen beim Einkauf von IT-Dienstleistungen:
- Die Einführung einer IT-Lösung beginnt regelmäßig mit der Suche und Auswahl eines Hard- oder Softwareprodukts. Der Vergleich von Hard- und Softwarelösungen stellt viele leitende IT-Mitarbeiter vor Herausforderungen: Die Recherche erfolgt mangels zentraler Informationsangebote wie Lösungsvergleiche oftmals mittels einer Webrecherche. Gefundene Informationen sind dann nicht einheitlich und sind mühsam aufzubereiten. Kommerzielle Informationsangebote decken entweder nicht den gewünschten Themenschwerpunkt ab oder sind für viele Unternehmen zu teuer.
- Vor der Einführung der ausgewählten Lösung, beziehungsweise der Ausschreibung der Leistung, erfolgt die Definition des Zielzustands mit einer IT-Architektur. Bei Ausschreibung der Einführung (Implementierung) oder der laufenden Wartung (Managed-Service) des IT-Systems findet zusätzlich die Anfertigung einer Leistungsbeschreibung statt. Anwenderunternehmen stehen vor der Herausforderung der Anfertigung dieser Dokumente. Die Unternehmen beginnen diesen Prozess oftmals ohne Vorlage, obwohl die meisten Lösungen in der Vergangenheit bereits vielfach eingeführt wurden. Die Anfertigung der Dokumente bedarf hoher personeller Ressourcen, was sogar dazu führen kann, dass das Projekt verschoben oder auf eine externe Vergabe an einen IT-Dienstleister verzichtet wird.
- Die Recherche nach einem passenden IT-Dienstleister fällt vielen IT-Verantwortlichen schwer. Da kein übergreifendes Branchenverzeichnis für die IT existiert, führt sie im Ergebnis meistens zu deutlich weniger möglichen Auftragnehmern, als am Markt verfügbar sind. Das wiederum reduziert den Wettbewerb unter diesen. Bestehende Partnerverzeichnisse enthalten nicht die gewünschten Informationen oder sind schwer zu durchsuchen.
- Die Verteilung von Ausschreibungen geschieht in der Regel als manueller Prozess im Rahmen dessen verschiedene IT-Dienstleister angeschrieben werden. Rückfragen gilt es individuell zu beantworten. Mit diesem manuellen Prozess steigt der Aufwand einer Ausschreibung praktisch linear zur Anzahl der Empfänger, weshalb die Liste der Empfänger vom IT-Management kurz gehalten wird. Dies führt zu weniger Angeboten und beschränkt damit den Wettbewerb.
- Die Durchführung des Ausschreibungsprozesses neben dem Tagesgeschäft ist für einige Unternehmen eine nur mit Mühe zu bewältigende Herausforderung. Da Ausschreibungen oftmals auch nicht regelmäßig erfolgen, sehen viele Anwenderunternehmen diesen Prozess als komplexe Angelegenheit. Einige Anwenderunternehmen würden gerne mehr Leistungen extern vergeben. Aufgrund internen Ressourcenmangels für die Anfertigung der Ausschreibung geschieht dies aber nicht und das Projekt wird verschoben oder nicht umgesetzt.
- Da immer mehr Leistungen durch externe IT-Dienstleister erbrachtet werden, nimmt auch das Provider-Management einer immer wichtigere Rolle ein. Einige Unternehmen fühlen sich damit überfordert. Gewünscht ist eine Instanz zur dauerhaften Verwaltung externer IT-Dienstleister. Im Gegensatz zu Unternehmensberatung soll dieses externe Provider-Management aber langfristig angelegt sein und deutlich günstiger, beziehungsweise effizienter in der Leistungserbringung sein. Gewünscht ist demnach eine Auslagerung (Outsourcing) bestimmter Teile des IT-Managements.
3.2 Aktivitäten
Ziel des Konzepts ist die spürbare Vereinfachung des Einkaufs von IT-Dienstleistungen. Dazu dient eine Reihe verschiedener Aktivitäten:
- Research-Dokumente ergänzen bestehende Angebote für den Vergleich von Hard- und Softwarelösungen. Sie sollen Anwenderunternehmen bei der Entscheidung für bestimmte Technologien unterstützen und so die folgenden Aktivitäten vorbereiten.
- Dokumentvorlagen für IT-Architekturen und Leistungsbeschreibungen ermöglichen die deutlich vereinfachte Anfertigung dieser. Damit wird die externe Vergabe von IT-Dienstleistungen erheblich vereinfacht, was wiederum zu einer häufigeren Ausschreibung dieser führt.
- Ein Anbieterverzeichnis ermöglicht einen Überblick über die am Markt aktiven IT-Dienstleister, ihr Leistungsportfolio, Referenzprojekte in Form von Fallstudien und weitere Merkmale. Mit diesem Verzeichnis ist es möglich, die Suche nach einem IT-Dienstleister deutlich effektiver und effizienter als bislang per Partnernetzwerk oder Websuche durchzuführen.
- Eine Ausschreibungsplattform in Form einer Webanwendung versetzt Anwenderunternehmen in die Lage, Ausschreibungen in einem systematischen Prozess an eine höhere Anzahl von IT-Dienstleistern zu verteilen. Die strukturierte Beantwortung von Rückfragen ermöglicht einen vereinfachten Prozess und damit die Entkopplung des Aufwands von der Anzahl der Empfänger der Ausschreibung.
- Eine Unterstützung des Ausschreibungsprozesses erfolgt als klassische Dienstleistung. Insbesondere komplexere oder bislang nicht in den Vorlagen abgebildete Vorhaben können so ebenfalls durchgeführt werden. Diese Aktivität skaliert im besten Fall mit dem Umfang des Auftrags, sodass auch kleinere Projekte Unterstützung erhalten können.
- Ein Outsourcing des Provider-Managements unterstützt die IT-Organisation im langfristigen IT-Management. Es handelt sich hierbei um ein Outsourcing von Geschäftsprozessen (englisch Business Process Outsourcing, BPO) in Abgrenzung zu Unternehmensberatung. Auch diese Aktivität skaliert im besten Fall mit dem Umfang des zu bewältigenden Provider-Managements.
Die Realisierung der vorgenannten Punkte ließe sich nur in mehreren Phasen angehen. Dabei sind die Elemente 1 bis 4 als Basisaktivitäten zu Beginn umzusetzen, die Elemente 5 und 6 als ergänzende Aktivitäten gestaffelt zu späteren Zeitpunkten. Bei letztgenannten ist die Wertschöpfung zu minimieren und insbesondere anfangs Partner (beispielsweise Unternehmensberatungen) in die Leistungserbringung zu integrieren. Die Kombination der verschiedenen Aktivitäten als integriertes Angebot ist bei der Umsetzung elementar. Nur so erhalten Anwenderunternehmen eine Lösung für den gesamten Prozess.
Im Detail sieht der Prozess für Anwenderunternehmen als Kunden wie folgt aus:
- Der Einkauf von IT beginnt in der Regel mit einem festgestellten Bedarf einer Fachabteilung nach einer Anwendung oder von IT-Infrastruktur seitens der zentralen IT-Organisation. Die bereitgestellten Research-Dokumente unterstützen Fachabteilung und IT-Organisation beim Vergleich verschiedener Lösungen. Sie erläutern nicht nur das Thema, sondern bieten auch einen Überblick über am Markt verfügbare Lösungen und deren Anbieter.
- Nach der Auswahl einer Lösung erfolgt die Ausarbeitung einer IT-Architektur. Übliche Elemente sind dabei unter anderem Diagramme wie Netzwerkpläne bei Infrastruktur oder Datenflüsse bei Anwendungen. Eine Leistungsbeschreibung bestimmt, welche Leistungen im Falle einer Ausschreibung erbracht werden müssen. Die bereitgestellten Dokumentvorlagen bieten für gängige Leistungen eine Grundlage für die zu erstellenden Dokumente. Damit können die Anwenderunternehmen die Ausschreibung in deutlich kürzerer Zeit anfertigen. Die Qualität der Dokumente ist zudem tendenziell höher; gängige Best-Practices werden berücksichtigt.
- Im Anschluss erfolgt die Suche nach möglichen IT-Dienstleistern als Auftragnehmer. Anstatt eine Websuche durchzuführen, wird auf das Anbieterverzeichnis zurückgegriffen. Ziel ist die Anfertigung einer sogenannten Longlist mit bis zu 50 Anbietern. Durch die Konzentration der Informationen auf einem Angebot kann die Recherche in deutlich kürzerer Zeit erfolgen. Referenzen in Form von Fallstudien unterstützen bei der Vorauswahl potenziell geeigneter IT-Dienstleister.
- Die angefertigte Ausschreibung mitsamt Architektur, Leistungsbeschreibung und ergänzenden Dokumenten wird den ausgesuchten IT-Dienstleistern über die Ausschreibungsplattform Rückfragen zur Ausschreibung werden nicht einzeln beantwortet, sondern gesammelt in Form von Ergänzungen der Ausschreibung. Diese Vorgehensweise ordnet den Prozess und ermöglicht vergleichbare Angebote der IT-Dienstleister auf Basis desselben Informationsstands. Die Vorschläge der IT-Dienstleister enthalten im besten Fall abgestimmte Referenzen, welche sich nach Rücksprache auch kontaktieren lassen. Das Anwenderunternehmen nimmt eine Auswahl in Form einer sogenannten Shortlist vor und tritt in weitere Verhandlungen mit diesen IT-Dienstleistern ein. Ab hier erfolgt der Prozess konventionell bilateral.
- Falls ergänzende Dienstleistungen bei diesem Prozess erforderlich sind, können diese in Form einer temporären Unterstützung des Ausschreibungsprozesses oder eines langfristigen externen Provider-Managements angeboten werden. Diese ergänzenden Dienstleistungen ermöglichen eine vollumfängliche Unterstützung des IT-Managements.
Die verschiedenen Aktivitäten bilden ein integriertes Angebot: Der zu Beginn geplante Online-Marktplatz findet sich in Form der Ausschreibungsplattform wieder. Die anderen Aktivitäten unterstützen die Ausschreibungsplattform nicht nur, sondern erweitern das Konzept und ermöglichen so einen deutlich erhöhten Kundennutzen.
3.3 Geschäftsmodell
Der Kern des Geschäftsmodells ist die Berechnung einer Provision für vermittelte Aufträge. Diese ist einzig durch die IT-Dienstleister zu tragen. Das Geschäftsmodell ist demnach das gleiche wie bei zahlreichen anderen Online-Marktplätzen. (Schlie et al. 2011)
Die Inanspruchnahme der Basisleistungen in Form von Research-Dokumenten, Dokumentvorlagen, Anbieterverzeichnis und Ausschreibungsplattform durch die Anwenderunternehmen ist für diese vollständig kostenlos.
Die Provision berechnet sich anhand eines festen Prozentsatzes auf Basis des Gesamtpreises des über die Ausschreibungsplattform vermittelten Auftrags. Bei der Auftragsvergabe nicht berücksichtigte IT-Dienstleister müssen somit auch keine Gebühren entrichten. Grundlage der Berechnung ist dabei grundsätzlich der in der Rechnung angegebene Betrag, wobei je nach Ausgestaltung nur Dienstleistungen berücksichtigt werden. (Eine Erweiterung auf den Markt für Hard- und Software wäre aber mit Änderungen möglich.)
Über die Plattform läuft die erste Phase des Ausschreibungs- und Angebotsprozesses. Detaillierte Verhandlungen unternehmen die Vertragspartner bilateral. Um einzelne Vorgänge nicht nachhalten zu müssen, werden abgeschlossene Verträge von den IT-Dienstleistern selbständig gemeldet und die Provision anschließend in Rechnung gestellt. Die Durchsetzung dieses Modells erfolgt auf Vertrauensbasis unter Androhung der Auslistung von Anbieterverzeichnis und Ausschreibungsplattform. IT-Dienstleister hätten jede Transaktion zu melden, welche auf Basis der Dokumentvorlagen hereinkommt. Somit ändert sich die Berechnung auch nicht für Anwenderunternehmen, die anstatt der Ausschreibungsplattform bereits eine andere Software für die elektronische Beschaffung im Einsatz haben.
Wichtig dabei ist eine offene und klare Kommunikation des Geschäftsmodells. Das beinhaltet eine klare Abgrenzung von weitergehenden Beratungsleistungen, denn diese vertragen sich nicht mit dem Provisionsmodell. Es besteht ein natürlicher Interessenkonflikt, welcher in anderen Branchen seit Jahren für erhebliche Diskussionen sorgt. (Beispielsweise provisionsgetriebene Beratung von Banken.) Somit verbittet sich auch langfristig eine Beratung bezüglich der Auswahl eines Vorschlags oder eines IT-Dienstleisters. Bekannte Online-Marktplätze versuchen in der Regel eine gewisse Distanz aufrechtzuerhalten und die Rolle eines Mittelsmannes einzunehmen.
Die IT-Dienstleister inkludieren die zu zahlende Provision in den Vorschlag, beziehungsweise in das spätere Angebot. Auch diesen Sachverhalt gilt es offen zu kommunizieren. Für eine nochmals weitergehende Transparenz wäre es sogar denkbar, die IT-Dienstleister die Provision auf den Rechnungen für die Anwenderunternehmen als eigenen Posten ausweisen zu lassen.
Aufgrund des Provisionsmodells ist der zu entrichtende Preis für die Nutzung des Online-Marktplatzes nicht absolut, sondern in Form eines relativen Prozentsatzes zu betrachten. Dieser Prozentsatz ließe sich erst später nach intensiver Marktrecherche und im Gespräch mit Anwenderunternehmen und IT-Dienstleistern bestimmen. Um dennoch eine Einordnung vornehmen zu können, sei an dieser Stelle auf die Vermittlung von Anlagegütern für kleine und mittlere Unternehmen verwiesen. Dabei werden zwischen 10% und 20% für die Vermittlung eines Auftrags verlangt. (Carney 2014)
Der Vorteil des festen Prozentsatzes ist zudem die automatische Justierung: Auf unterschiedliche Tarife, Rabattsysteme oder gar Preisverhandlungen mit den IT-Dienstleistern kann verzichtet werden.
Für beide Seiten, Anwenderunternehmen und IT-Dienstleister, soll die Nutzung der Ausschreibungsplattform auch finanzielle Vorteile mitbringen. Dazu empfiehlt sich ein Blick auf die Maße Gesamtbetriebskosten (englisch Total Cost of Ownership, TCO) und Anlagenrentabilität (englisch Return on Investment, ROI). Die Vorteile des Konzepts stellt das nachfolgende Kapitel dar.
Die Frage, ob es möglich ist, das beschriebene Geschäftsmodell gewinnbringend und damit lohnenswert umzusetzen, ist nur in Abhängigkeit des Marktvolumens und der Kosten zu beurteilen.
3.4 Wertbeitrag
Der Wertbeitrag eines Online-Marktplatzes ist in der Literatur vielfach dargestellt und hat sich in der Praxis bewiesen. An dieser Stelle wird sich auf die spezifischen Vorteile der Adoption des Konzepts auf den Bereich der IT-Dienstleistungen beschränkt.
Übergreifendes Ziel ist die Vereinfachung von IT. In Abgrenzung zu besser, schneller, günstiger ist die Vereinfachung einerseits ein übergreifendes, andererseits ein emotionales Ziel: Sie entlastet die Mitarbeiter in einer stets komplexer werdenden Welt. Dies ist auch der Brückenschlag von Wertbeitrag zu den Kundenbeziehungen.
Für Anwenderunternehmen ergeben sich im Detail eine Reihe von Vorteilen:
- Information: Informationen sind zentral und einheitlich zur Verfügung gestellt. Insbesondere Recherchetätigkeiten werden damit erheblich reduziert. Durch die Kenntnis von Anbietern, Lösungen und Leistungen lässt sich schneller eine Entscheidung treffen. Die Zusammenführung von Informationen verschiedener Quellen und Reduzierung auf die wesentlichen Punkte erleichtert das Zurechtfinden bei der Suche nach Produkten und IT-Dienstleistungen. Umständliche Recherchen auf den Webseiten der Anbieter lassen sich deutlich reduzieren. Durch die Konzentration der Informationen und die direkte Gegenüberstellung sind zudem Unterschiede stärker herausgearbeitet. Genau diese Unterschiede sind jedoch die relevanten Punkte, nach denen bislang mühsam gesucht werden muss.
- Geschwindigkeit: Die Kombination von Informationen mit einem Prozessmodell und einer Webanwendung zur Umsetzung dessen, ermöglichen einen erheblich beschleunigten Einkaufsprozess. Damit ließe sich der Einkauf von IT-Dienstleistungen spürbar verkürzen. Die ergänzenden Aktivitäten ermöglichen den Rückgriff auf Unterstützung, ohne diese Leistungen ebenfalls auszuschreiben.
- Kostensenkung: Das Konzept senkt die Kosten des Einkaufs von IT-Dienstleistungen an mehreren Stellen: Transaktionskosten in Form von Anbahnungs-, Informationsbeschaffungs- und Vereinbarungskosten werden durch Informationen, einen Geschäftsprozess und eine Webanwendung gesenkt. Das ermöglicht die Anforderung von Angeboten von deutlich mehr IT-Dienstleistern. Das Konzept verstärkt den Wettbewerb und führt damit zu einem effizienteren Markt, welcher sich in niedrigeren Preisen bemerkbar macht. Mit einem strukturierten Vergabeprozess und damit mehr Vorschlägen (Angeboten) lassen sich zudem bessere oder zumindest passendere Leistungen einkaufen.
Auch IT-Dienstleister profitieren von dem Konzept:
- Information, Geschwindigkeit und Kostensenkung: Das Informationsangebot ist in der Regel auch für IT-Dienstleister sinnvoll. Zwar sollten diese in der Regel einen guten Überblick über aktuelle Trends ihrer Branche besitzen, doch kann die Bündelung auch hier sinnvoll sein. Das Anbieterverzeichnis ist zur Beobachtung des Wettbewerbs und zur eigenen Positionierung gegenüber diesem hilfreich. Der prozessorientierte Ansatz zur Bearbeitung von Ausschreibungen unter Einbeziehung einer Webanwendung vereinfacht auch bei IT-Dienstleistern den Prozess. Sie senken ihre Transaktionskosten, und können diese Kostensenkung an ihre Kunden weitergeben.
- Marketing: IT-Dienstleister erhalten darüber hinaus eine zentrale Plattform zur Kommunikation des eigenen Angebots. An dieser Stelle lassen sich die eigenen besonderen Kompetenzen im direkten Vergleich hervorheben. Die Reichweite des eigenen Angebots wird damit massiv erhöht. Insbesondere kleinere, spezialisierte Anbieter können Ihr Angebot einer hohen Anzahl potenzieller Kunden präsentieren. Größere Anbieter werden bei der Markteinführung neuer Dienstleistungen oder dem Aufbau weiterer Kompetenzen unterstützt. Die Alternative sind teure Werbekampagnen und die händische Information potenzieller Kunden. Wichtig ist zudem die zeitlich passende Kommunikation: Anstatt Kaltakquise und Marketing zu betreiben, sind die Informationen dann präsent, wenn Anwenderunternehmen nach ihnen suchen. Die Pflege von Referenzen ermöglicht ein zentrales Reputationsmanagement, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen: Potenzielle Kunden erfahren schnell, wie zufriedene Kunden zu einem bestimmten IT-Dienstleister stehen und in welchen Bereichen konkret Projekte durchgeführt wurden.
- Positionierung: Die erweiterten Möglichkeiten des Marketings und die damit einhergehende erhöhte Reichweite erlauben IT-Dienstleistern ihre strategische Positionierung zu überarbeiten. Insbesondere der bislang weit verbreitete Ansatz des Vollsortiments ist mit dem dargestellten Konzept nicht mehr zwingend notwendig: Durch die erhöhte Reichweite werden mehr potenzielle Kunden erreicht, was wiederum eine Spezialisierung erlaubt. Selbst DAX-Konzerne beauftragen mitunter Unternehmen mit einer zweistelligen Anzahl an Mitarbeitern, weil diese über eine besondere Kompetenz beziehungsweise Marktpositionierung verfügen. Kosteneffizienz durch Erfahrung ist nur mit einer hohen Anzahl ähnlicher Aufträge zu erreichen. Das dargestellte Konzept unterstützt eine solche Spezialisierung.
Des Weiteren ergeben sich positive Implikationen für die Branche insgesamt:
- Vereinfachung: Die Aktivitäten lassen sich dabei auch als sechs Schritte zu einer neuen Form des Einkaufs von IT betrachten. Standardleistungen, wozu alle Managed-Services und Tätigkeiten rund um Standardsoftware gehören, lassen sich deutlich einfacher einkaufen und erbringen. Wenn Unternehmen standardisierte Leistungen in wenigen Wochen planen und durchführen (lassen), hat dies auch Auswirkungen auf Themen wie die digitale Transformation des Geschäfts: Die Ressourcen der IT-Organisation sind begrenzt. Umso weniger dieser knapper Ressourcen für Standardleistungen aufgebracht werden müssen, desto mehr stehen für strategische Transformationsprojekte zur Verfügung. Das Konzept entlastet IT-Mitarbeiter der Anwenderunternehmen im täglichen Geschäft, welche sich daher auf strategische IT-Projekte konzentrieren können. IT-Dienstleister forcieren entweder den Umbau zur IT-Fabrik, welche hochstandardisierte Leistungen mit geringer Wertschöpfungstiefe erbringt oder erbringen tatsächlich strategisch relevanten Nutzen für Anwenderunternehmen. Mit den im letzten Kapitel vorgestellten Weiterentwicklungen ergeben sich nochmals weitere erhebliche Auswirkungen auf die Branche.
- Etablierung von Standards: IT ist schon heute zu einem hohen Grad standardisiert: IT-Management-Frameworks geben detaillierte Best-Practices vor, die von den meisten Unternehmen ab einer bestimmten Größe eingesetzt werden. Diese definieren Prozesse, wie Architekturen zu entwerfen und IT-Dienstleistungen zu erbringen sind. Welche Leistungen beziehbar sind und welche Bestandteile diese enthalten, könnte dagegen das hier vorgestellte Konzept branchenweit definieren. Dazu käme ein einheitlicher Aufbau von IT-Ausschreibungen im Rahmen eines (zu einem späteren Zeitpunkt) zu entwickelnden Frameworks für Leistungsbeschreibungen.
Zusammengefasst zeigen sich für beide Seiten erhebliche Vorteile durch das hier beschriebene Konzept: Nicht nur einzelne Marktteilnehmer könnten profitieren, sondern die gesamte Branche. Die Vergangenheit zeigt anhand anderer Branchen, dass bis Vereinfachung und Standardisierung erkannt sind, sie argwöhnisch betrachtet werden. Natürlich bewirkt eine erhöhte Transparenz auch immer eine Konsolidierung des Marktes. Dies kann aber insbesondere für Anwenderunternehmen durchaus positiv sein.
3.5 Kundengruppen
Zielgruppe des Konzepts sind Unternehmen, welche Aufträge an externe IT-Dienstleister vergeben möchten. Dabei lassen sich unterschiedliche Kundengruppen mit jeweils eigenen Schwerpunkten definieren.
Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Anforderungen auch in den einzelnen Gruppen teils stark unterscheiden. Beispielsweise besitzt ein fertigendes Unternehmen der Prozessindustrie im Bereich Pharma deutlich höhere Anforderungen an Software zur Einhaltung von Rechtsvorschriften (Compliance) als eine Werbeagentur derselben Größe.
Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern besitzen oftmals keinen eigenes IT-Personal und somit auch keine IT-Abteilung. Für sie kommen kämen nur Leistungen im Rahmen einer Weiterentwicklung des Konzepts in Frage.
Kleine und mittlere Unternehmen mit zehn bis 100 Mitarbeitern arbeiten regelmäßig mit einem einzelnen IT-Dienstleister oder freien IT-Mitarbeiter zusammen. Diese führen dabei jeweils praktisch alle Aufträge aus. Bei Anwenderunternehmen dieser Größe zeigt sich seltener der Bedarf nach Unterstützung im Einkaufsprozess einzelner Leistungen. Anders beim Wechsel des IT-Dienstleisters: Wenngleich das relativ selten oder nur bei stark wachsenden Unternehmen erfolgt, ist in diesem Fall tatsächlich Bedarf nach Unterstützung vorhanden.
In der Klasse des gehobenen Mittelstands mit 100 bis 1.000 Mitarbeitern vollzieht sich der Wandel von einer ad-hoc-IT zu einem ansatzweise professionellen IT-Management. Viele dieser Unternehmen wünschen sich einen strukturierten Ausschreibungsprozess, können diesen aber nicht aus eigener Kraft aufbauen. Demnach besteht der Bedarf nach Unterstützung. Gleichzeitig sind die bestehenden IT-Landschaften noch nicht übermäßig komplex, sodass selbst einfache Dokumentvorlagen bereits eine signifikante Unterstützung bringen könnten. Oftmals besitzen diese Unternehmen ebenfalls nur einen IT-Dienstleister, welcher gegebenenfalls selber eigene Partner hinzuzieht. Gleichwohl wünschen sich viele IT-Leiter mehr Wettbewerb für ihre IT-Leistungen. Insbesondere das Anbieterverzeichnis könnte hier einen schnellen Marktüberblick bieten.
Größere Unternehmen mit 1.000 bis 10.000 Mitarbeitern besitzen in der Regel deutlich komplexere IT-Landschaften und systematische Vergabeprozesse. Die IT ist zu komplex, um nur einen IT-Dienstleister zu beauftragen. Dabei ist mehr Wettbewerb gewünscht: Insbesondere für den Aufbau professioneller IT-Prozesse fehlen aber oftmals die Kapazitäten. Standardprojekte binden einen Großteil der Ressourcen, welche nicht für wertschöpfende strategische Projekte zur Verfügung stehen. Die schriftliche Definition der Architektur und die Anfertigung von Ausschreibungen ist einer der größten Herausforderungen. Mit Dokumentvorlagen ließen sich diese Unternehmen signifikant unterstützen. Die Ausschreibungsplattform böte diesen Unternehmen zudem die Möglichkeit, IT-Ausschreibungen professionell durchzuführen. Wenn bereits eine Software zur elektronischen Beschaffung eingeführt ist, könnte die Ausschreibungsplattform diese ergänzen. Alternativ erfolgt nur der Einsatz der bereits eingeführten Lösung. Die ergänzenden Aktivitäten, abgerechnet zu einem automatisch skalierenden Preis, könnten hier eine sinnvolle Alternative zu Unternehmensberatungen bieten. Der finanzielle Rahmen der Projekte dieser Unternehmen beträgt schnell über 100.000 Euro, manche Anwenderunternehmen schreiben eine Leistung auch erst ab dieser Summe aus. Das ließe auf die Abrechnung hochwertiger Leistungen hoffen. Größere Unternehmen sind damit die Hauptzielgruppe des Konzepts.
Große Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern verfügen über ein ausgereiftes IT-Management mit entsprechenden Beschaffungsprozessen. Gleichzeitig ist neben einigen großen auch eine Vielzahl kleinerer Aufträge extern zu vergeben. Dabei werden nicht nur große IT-Dienstleister berücksichtigt. Große Unternehmen besitzen oftmals ein System für das Supplier-Relationship-Management, welches auch der Vergabe von IT-Dienstleistungen dient. Die Ausschreibungsplattform hätte demnach keinen Wertbeitrag. Große Unternehmen verfügen aufgrund der Vielzahl der IT-Projekte über Erfahrung in der Durchführung dieser und somit auch über entsprechende Dokumentvorlagen. Diese sind aus rechtlichen Gründen zudem stark an das eigene Unternehmen angepasst. Für große Projekte (ab ca. 10 Mio. Euro) wird oftmals externe Sourcing-Beratung eingekauft. Gleichwohl besteht bei neuen Themen (aktuell beispielsweise Cloud-Computing) Bedarf nach Unterstützung im Einkaufsprozess: Wenn es sich dabei um kleinere Aufträge handelt, kämen Dokumentvorlagen gelegen. Große Unternehmen würden diese eher als inhaltlichen Input, denn als Vorlage nutzen. Demnach würden große Unternehmen erst später in den Fokus rücken, da für den Vertrieb an diese das Konzept einen hohen Reifegrad besitzen muss.
Zu einem späteren Zeitpunkt sollten große Unternehmen aber sehr wohl eine Kundengruppe darstellen. Das Marktvolumen ist zu groß, um langfristig keine Beachtung zu finden. Die Dokumentvorlagen könnten um Benchmarking-Daten erweitert werden und auch rechtliche Details enthalten. Sie sind demnach für diese Zielgruppe gesondert anzufertigen. (Ansonsten würden sie zu komplex für die anderen Unternehmensklassen werden.) Die Ausschreibungsplattform könnte weitere Elemente für das IT-Management, insbesondere das Provider-Management, enthalten. Denkbar wäre aber auch eine Änderung des Geschäftsmodells: In diesem Fall würde primär eine Lizenzierung der Dokumentvorlagen und der Vertrieb der ergänzenden Aktivitäten erfolgen. Ein Vertrieb der Ausschreibungsplattform als Software-as-a-Service käme weniger in Frage, da sich bereits eine Vielzahl solcher Systeme auf dem Markt befinden. Eine Konkurrenzsituation zu existierenden Lösungen zur elektronischen Beschaffung oder für das IT-Management wäre unbedingt zu vermeiden.
Grundsätzlich richtet sich das Konzept an Unternehmen aller Branchen. Im Bereich der IT-Infrastruktur bestehen nur wenige Unterschiede zwischen diesen. Bei Anwendungen gilt es sich anfangs auf horizontale Systeme zu konzentrieren. Vertikale branchenspezifische Anwendungen sind zu komplex, insbesondere da der Aufwand höher und die Anzahl der entsprechenden Unternehmen geringer ist.
Das Konzept ist nicht für Organisationen der öffentlichen Verwaltung nutzbar. Die in diesem Bereich durchgeführten Ausschreibungen erfordern spezielle Softwarelösungen, um rechtlichen Anforderungen zu genügen. Die Architekturen und darauf aufbauenden Leistungsbeschreibungen sollen durchaus einen innovativen Charakter besitzen und neue Technologien fördern. Dies schließt die Verwendung in der öffentlichen Verwaltung aus.
Das Konzept richtet sich prinzipiell an IT-Dienstleister aller Größenordnungen. Der Markt für IT-Dienstleistungen teilt sich weniger als andere nach der Größe der Marktteilnehmer. Auch kleine IT-.Dienstleister erhalten Aufträge von DAX-Unternehmen und große IT-Dienstleister haben auch mittelständische Kunden. Große IT-Dienstleister, welche keine mittelständischen Kunden besitzen, sind anfangs nicht in das Konzept einzubeziehen.
Die dargestellte Ausgestaltung des Konzepts beinhaltet eine Abgrenzung zwischen Softwareanbieter und IT-Dienstleister. Aufgrund der Überschneidungen innerhalb der Branche sind hier zu einem späteren Zeitpunkt eventuell Überarbeitungen notwendig.
Neben klassischen IT-Dienstleistern ließen sich auch Unternehmensberatungen mit Schwerpunkt IT-Managementberatung, Entwickler von Individualsoftware und Schulungsunternehmen adressieren. Die Bereiche überschneiden sich zwar, doch wäre aufgrund der hohen Anzahl der Marktteilnehmer dennoch eine inkrementelle Vorgehensweise notwendig.
3.6 Vertriebswege
Der Vertrieb an die Anwenderunternehmen erfolgt besonders zu Beginn direkt. Zwar ergeben sich manche Vorteile für die IT-Dienstleister, doch werden diese ihre Kunden höchstwahrscheinlich nicht auf ein Angebot hinweisen, welches den Vergleich mit dem Wettbewerb zum Ziel hat. So bleibt zu Beginn die direkte Information der Anwenderunternehmen.
Der direkte Vertrieb beschränkt sich auf die Information potenzieller Nutzer anstatt des klassischen aktiven Vertriebs des Angebots: Es handelt sich um ein neuartiges Konzept, welches in der Form auch keine direkte Konkurrenz besitzt. Anstatt des Vertriebs werden Anwenderunternehmen über die Existenz des Angebots nur informiert. Dies erfolgt sowohl online, als auch offline. Neben der direkten Information von Anwenderunternehmen auf dem Postweg, ist Suchmaschinenmarketing ein wesentlicher Vertriebsweg.
Zum Start sind mit den Anbietern von Hard- und Software die Research-Dokumente und Dokumentvorlagen zu erstellen. Diese Zusammenarbeit ist im Laufe der Zeit auszudehnen. Hard- und Softwareanbieter haben ein großes Interesse am Vertrieb ihrer Lösungen und die Implementierung durch Partner. Langfristig wäre sogar denkbar, dass die Soft- und Hardwareanbieter das hier dargestellte Konzept neben ihren Partnerportalen vermarkten.
Ergänzend zur Vermittlung von Implementierungspartnern ist zudem denkbar, dass das Konzept von den Hard- oder Softwareanbieter für den eigenen Vertrieb genutzt wird. Dabei antworten Lösungsanbieter mit Marketing- und Vertriebsaktivitäten auf einen eingestellten Informationsbedarf. Anstatt sich also die notwendigen Informationen über eine Lösung selber zu beschaffen, fragt das Anwenderunternehmen nach Informationen auf Grundlage der bestehenden IT-Landschaft beziehungsweise der abzulösenden Systeme. Daraufhin antwortet der Lösungsanbieter mit entsprechenden Informationen. Im Rahmen dessen erfolgt auch die gemeinsame Suche nach einem geeigneten IT-Dienstleister.
Eine spätere Möglichkeit der Vermarktung ist die Bildung von Netzwerken unter Spezialisierung einzelner IT-Dienstleister. In diesem Fall konzentrieren sich insbesondere kleinere IT-Dienstleister stärker auf ihre Kernkompetenzen und kooperieren mit anderen.
Spezialisierte Unternehmensberatungen bieten verschiedene Leistungen zur Unterstützung im Einkauf von IT-Dienstleistungen. Insbesondere die Anfertigung von Strategie-Dokumenten und Ausschreibungen, das Provider-Management und das Projektmanagement sind dabei typische Leistungen. Im Rahmen von Kooperationen könnten diese Unternehmensberatungen auf das Angebot zurückgreifen und darauf aufbauen eigene Leistungen anbieten.
3.7 Kundenbeziehungen
Als Webangebot für geschäftliche Anwender weist das Konzept Merkmale eines Online- und eines Offline-Produkts auf. An dieser Zweiteilung hat sich auch die Marketing- und Vertriebsplanung auszurichten.
Die Maßnahmen zur Interaktion mit den Kunden sind auf verschiedene Bereiche verteilt:
- Kundenakquise offline: Die Akquise von Anwenderunternehmen erfolgt offline durch klassische Informationsaktivitäten: Die IT-Leiter werden auf dem Postweg angeschrieben und dabei über das Angebot informiert. Neben dieser klassischen Akquise ist Öffentlichkeitsarbeit ein zweiter wichtiger Pfeiler: Pressemitteilungen informieren einschlägige Branchenmedien über das Angebot. Die Kommunikation über die Medien hat den Vorteil, dass eine hohe Reichweite erzielt und gleichzeitig das Konzept näher erläutert wird. Insbesondere bei neuen Konzepten ergibt sich ein hoher Erklärungsbedarf, welchem sich damit begegnen lässt.
- Kundenakquise online: Darüber gilt es das Angebot in Form von Online-Marketing zu kommunizieren. Heutzutage ist auch in konservativen Branchen eine Webrecherche der Einstiegspunkt, um sich über ein Thema zu informieren. Suchmaschinenmarketing (englisch Search Engine Marketing, SEM), bestehend aus Suchmaschinenoptimierung (englisch Search Engine Optimization, SEO) und Suchmaschinenwerbung (englisch Search Engine Advertising, SEA) ist ein gängiges Mittel, um ein Webangebot bekannt zu machen. SEO optimiert die Webseite für Suchmaschinen, im Rahmen von SEA werden Werbeanzeigen bei diesen gebucht. Anwenderunternehmen, welche nach IT-Dienstleistungen suchen, finden so das dargestellte Konzept.
- Kundenhaltung offline: Das Angebot ist einerseits auf eine spontane Nutzung bei Bedarf, andererseits auf die Etablierung langfristiger Kundenbeziehungen ausgelegt. Die Optimierung der Zusammenarbeit mit den Anwenderunternehmen und IT-Dienstleistern und die Weiterentwicklung der Dokumente ist dabei Kernbestandteil der täglichen Arbeit. Um Anwenderunternehmen zur erneuten Nutzung zu bewegen, muss insbesondere das Angebot an Informationen, Dokumentvorlagen und das Anbieterverzeichnis stetig weiterentwickelt werden.
- Kundenhaltung online: Anwenderunternehmen gilt es auf Neuerungen beispielsweise per E-Mail-Newsletter hinzuweisen. Kundenumfragen und die Möglichkeit zur Einreichung von Verbesserungsvorschlägen ergeben einen direkten Draht zu den Bedürfnissen der Kunden. Zu einem späteren Zeitpunkt gilt es die Ausschreibungsplattform um soziale Elemente zu ergänzen. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit der direkten Kommunikation zwischen Anwenderunternehmen und IT-Dienstleistern oder dem Austausch zwischen IT-Mitarbeitern. Ein Unternehmensblog gibt Einblicke in die tägliche Arbeit, ein IT-Blog zeigt Trends der Branche auf. (Letzteres sollte sich dabei deutlich von bestehenden Angeboten abgrenzen.)
- Kundenwachstum offline: Eine Vorgehensweise, möglichst viele Leistungen über die Plattform ausschreiben zu lassen, ist die Aufteilung der Architekturen und Leistungsbeschreibungen in möglichst viele Einzelkomponenten. Zwar erhöht sich damit nicht das Investitionsvolumen, doch ermöglicht diese Vorgehensweise die stückweise Ausschreibung einzelner Leistungen. Im Vergleich zu einer großen integrierten Ausschreibung, sinkt bei einzelnen kleineren Ausschreibungen der Aufwand. Sinnvoll wäre zudem ein Programm, um Weiterempfehlungen des Angebots zu honorieren.
- Kundenwachstum online: Anwenderunternehmen gilt es bei der Weiterempfehlung des Angebots zu unterstützen. Dazu sollte Wissen bezüglich Branchen und Funktionen aufgebaut werden. Informelle Netzwerke zwischen IT-Verantwortlichen ließen sich online durch soziale Elemente abbilden.
Die Kombination eines Webangebots mit klassischen B2B-Elementen bedarf einer diversifizierten Kommunikation gegenüber den Kunden. Dabei können bestehende Angebote, insbesondere B2B-Markplätze, als Beispiel dienen.
3.8 Ressourcen
Als Webangebot handelt es sich prinzipiell um ein ressourcenarmes Konzept, da übliche Anlagegüter wie Maschinen nicht notwendig sind.
Grundsätzlich ergeben sich vier wesentliche Ressourcen:
- Personal: Das Personal in Form von Softwareentwicklern und IT-Architekten ist wie für andere Webangebote die wichtigste Ressource. Dieses zu akquirieren und zu halten ist auch die größte Herausforderung. Eine Möglichkeit dem zu begegnen ist die von Beginn an internationale Ausrichtung. Dabei erfolgt die Entwicklung des Konzepts vollständig auf Englisch. Das eröffnet ein größeres Potenzial von Humanressourcen. Zudem können über das Internet freie Mitarbeiter unter Vertrag genommen werden.
- Webanwendung: Wichtigste konventionelle Ressource ist die Webanwendung in Form des Anbieterverzeichnisses und der Ausschreibungsplattform. Die Webanwendung ist auch elementar bei der Weiterentwicklung des Konzepts: Einerseits auf weitere Bereiche in der IT, andererseits aber auch auf andere Branchen. Sie könnte aber auch als Software-as-a-Service an Dritte Unternehmen für eigene Ausschreibungsplattformen lizenziert werden.
- Dokumentvorlagen: Die Dokumentvorlagen sind insbesondere zu Beginn die wertvollste Ressource. Wie sich zeigt, besteht hier bei vielen Unternehmen starker Bedarf. Dazu kommt, dass bislang kaum alternative Angebote existieren. Wenn langfristig eine Gemeinschaft um die Dokumentvorlagen entstehen soll, müssten diese jedoch wahrscheinlich als Open-Content unter einer freien Lizenz bereitgestellt werden.
- Netzwerkeffekt: Der Nutzen des Konzepts steigt, umso mehr Unternehmen es nutzen. Die breite Nutzung der Dokumente verbessert diese inkrementell. Wichtigster Punkt ist jedoch, dass die Reichweite eines Online-Marktplatzes mit der Anzahl der Nutzer steigt. Neue Nutzer, in diesem Fall Anwenderunternehmen und IT-Dienstleister, führen zu weiteren Nutzern. Wenn eine kritische Masse erreicht wird, steigt ab da die Nutzerzahl exponentiell. Der Netzwerkeffekt unterscheidet Marktplätze auch von reinen Verzeichnissen. Diese, so auch das Anbieterverzeichnis, lassen sich relativ einfach kopieren. Die Schwierigkeit in der Etablierung des Netzwerkeffekts liegt in der anfänglichen Kommunikation des Angebots gegenüber den Nutzern. Nur wenn sich eine kritische Masse erreichen lässt, erfolgt das Wachstum automatisiert.
Die Ressourcen sind vergleichbar mit denen bekannter Online-Marktplätze. Wie bei diesen besteht die Herausforderung in der Schaffung von Barrieren gegenüber Nachahmern. Die Dokumentvorlagen sind dabei das wichtigste Element.
3.9 Partner
Neben den Ressourcen ist das Konzept von weiteren externen Partnern abhängig. Diese gilt es in die Wertkette zu integrieren. Das Ziel besteht in der Etablierung eines breiten Netzwerks unterschiedlicher Unternehmen, deren Leistungen sich gegenseitig ergänzen. Das Konzept soll demnach nicht nur eine Mittlerrolle mit den Anwenderunternehmen, sondern auch zwischen verschiedenen IT-Dienstleistern einnehmen.
Zur Entwicklung der Dokumentvorlagen ist Vorgesehen, mit Hard- und Softwareanbietern zu kooperieren. Einerseits besitzen diese die notwendige Erfahrung in der Implementierung ihrer eigenen Lösungen. Sie sind die Quelle des Fachwissens, auch bei der Implementierung anbieterübergreifender Architekturen. Andererseits besitzen sie ein Interesse am Verkauf ihrer Lösungen. Wo es technisch sinnvoll erscheint, sollen die Dokumentvorlagen herstellerneutral sein. Insbesondere die Research-Dokumente geben den Hard- und Softwareanbietern dennoch die Möglichkeiten, ihre Lösungen zu kommunizieren. Bei einer Erweiterung des Konzepts auf den Einkauf von Hard- und Software würde dies weiter verstärkt werden. Darüber hinaus sind die Verbreitung übergreifender Konzepte, wie das Cloud-Computing, und Trends wie Social-Collaboration im Interesse aller Anbieter. Die Anbieter verfügen über große Vertriebskapazitäten, die nicht selten neue Möglichkeiten des Marketings suchen.
Bei der Coopetition genannten Zusammenarbeit ansonsten konkurrierender Unternehmen arbeiten diese an einer gemeinsamen Initiative oder im Rahmen eines Projektes zusammen. Wenn dies bei den Dokumentvorlagen gelingen könnte, würde sich die Anfertigung nochmals deutlich beschleunigen. Die Arbeitsweise entspräche dem eines Wikis. Zahlreiche bestehende Kooperationen zeigen, dass diese Form der Zusammenarbeit für die Unternehmen nichts Neues wäre. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit von Microsoft und SAP, obwohl beide gleich mehrere konkurrierende ERP-Systeme anbieten. Oftmals führt der Druck der Anwender zu solchen Kooperationen.
Weitere potenzielle Partner wären spezialisierte Unternehmensberatungen mit dem Schwerpunkt IT-Management. Insbesondere die Bereiche Sourcing-Beratung, Provider-Management und Unterstützung bei der Auswahl von Software erlauben eine frühzeitige Entwicklung der ergänzenden Aktivitäten.
3.10 Marktvolumen
Die Bestimmung des Marktvolumens ist oftmals eine Herausforderung. Je nach Betrachtungswinkel sind völlig verschiedene Annahmen und damit Zahlenwerke möglich. Anstatt fester Voraussagen zu Marktgröße und Wachstum sei an dieser Stelle nur auf einige Kenngrößen hingewiesen.
Zur Bestimmung des Marktvolumens sind die Begriffe Gesamtmarkt (Total Adressable Market, TAM), erreichbarer Markt (Served Available Market, SAM) und Zielmarkt (Target Market, TM) hilfreich. (Blank et al. 2012, 72f)
Der Markt für Informationstechnik (Hardware, Software, Dienstleistungen; ohne Consumer-Electronics und Telekommunikation) in Deutschland beträgt 74,7 Milliarden Euro. Das Marktvolumen für IT-Dienstleistungen beträgt 35,4 Milliarden Euro (beide im Jahr 2013). Die 25 größten IT-Beratungs- und Serviceunternehmen vereinen 23 Milliarden Euro auf sich. Der Anteil aller anderen kleineren IT-Dienstleister liegt demnach bei ca. 35%. (Zillmann 2014)
Der Gesamtmarkt in Deutschland betrüge bei einer Provision in Höhe von 10% 7,5 Milliarden Euro. Angenommen, das anfängliche Ziel besteht in der Abwicklung von 1% der IT-Dienstleistungen über das Webangebot, betrüge der Zielmarkt 0,1% des Gesamtmarktes (35,4 Millionen Euro).
Interessanter als solche rein nationalen Zahlenspiele ist jedoch die Forcierung einer möglichst frühzeitigen Internationalisierung des Konzepts. Gerade die Positionierung als Webangebot im Vergleich zu Beratungsleistungen lässt diesen Weg zu. Als B2B-Angebot im Bereich der bereits relativ stark internationalisierten IT-Branche ist zudem der Aufwand der Lokalisierung beherrschbar.
Zudem wird bei vielen neuen Konzepten der Gesamtmarkt als Indikator für das Potenzial des Konzepts betrachtet. Galston (2015) unterscheidet dabei zwischen Märkten mit weniger und solchen mit mehr als 100 Milliarden US-Dollar Marktvolumen in den Vereinigten Staaten. Das Volumen des Marktes für IT in Unternehmen in den Vereinigten Staaten beträgt definitiv mehr als 100 Milliarden US-Dollar. (Aufgrund der undurchsichtigen Quellenlage gestaltet sich eine genauere Auswertung schwierig.) (Advisen Insurance Intelligence 2012; Galbraith 2013; PR Newswire 2015)
3.11 Kosten
Nur wenn neben einem funktionierendem Geschäftsmodell und einem hohen Marktvolumen die Kosten niedriger als die Erlöse sind, ist das Geschäftsmodell profitabel. Als Online-Marktplatz in einem neuen Markt ist für das Konzept eine besonders lange Anlaufphase einzuplanen. An dieser Stelle erfolgt eine Einordnung der strukturellen Kosten. (Blank et al. 2012, 120ff)
Es entstehen hauptsächlich Personalkosten. Kosten für die Bereitstellung (Hosting) der Webanwendung sind heutzutage vernachlässigbar. Die Personalkosten fallen dabei als Kostenblock in Form von Fixkosten an. Zwar steigen diese bei weiterer Professionalisierung, jedoch ist im Vergleich zu Unternehmensberatungen grundsätzlich eine Skalierung des Geschäftsmodells möglich: Neue Kunden führen nicht zu linear steigenden Kosten.
Zur Senkung der Kosten empfiehlt sich ein hoher Automatisierungsgrad bei der Leistungserbringung. Verfügbares Wissen ist von Beginn an so aufzubereiten, dass es zur Unterstützung der der Anwenderunternehmen veröffentlicht werden kann.
Die ergänzenden Aktivitäten zur direkten Unterstützung der Anwenderunternehmen im Einkaufsprozess und im IT-Management sind wie klassische Beratungsleistungen nicht skalierbar. Hierbei steigen die Kosten mit der Anzahl der Kunden praktisch linear. Zwar lassen sich mit der Zeit gewisse Effizienzgewinne realisieren, doch am Grundprinzip der persönlichen Beratung ändert das nichts. Bei der Realisierung mit Partnern gestaltet sich das wiederum anders: Hier wären analog zur Provision über vermittelte IT-Dienstleistungen auch die Beratungsleistungen über einen prozentualen Umsatzanteil zu verrechnen.
Im Sinne einer Stärkung des skalierbaren Teils des Konzepts sind die Kosten ehrlich zu kommunizieren und weiterzugeben. Das heißt, dass Beratung unbedingt als solche gekennzeichnet und dementsprechend berechnet wird. Somit erfolgt eine klare Trennung der für das Anwenderunternehmen kostenlosen und ergänzenden Leistungen.
In jedem Fall ist eine Entwicklung zu einem Beratungsunternehmen zu vermeiden. Das Geschäftsmodell der Unternehmensberatung ist bereits mit einer Vielzahl von Marktteilnehmern besetzt. Der Markt für Unternehmensberatung wächst zudem nur noch sehr gering.
3.12 Klassifizierung des Marktes
Zur Positionierung des Konzepts im Markt ist es unabdingbar, eine Klassifizierung dessen vorzunehmen. Dabei wird zwischen existierendem Markt, neu segmentiertem Markt, neuem Markt und geografisch neuem Markt (Adoption eines Konzepts in einem geografisch neuen Markt) unterschieden. (Blank et al. 2012, 112-124)
Basis ist der Markt zur Vermittlung(!) von IT-Dienstleistungen. An diesen Markt grenzen sowohl Beratungsleistungen, wie die IT-Sourcing-Beratung und das Provider-Management, aber auch Softwarelösungen zur elektronischen Beschaffung. Nachfolgend erfolgt eine Näherung an die Thematik, eine abschließende Beurteilung des Marktes wäre erst nach Beginn der Umsetzung des Konzepts möglich.
Der Markt ist nach Blank et al. (2012) anhand verschiedener Dimensionen zu klassifizieren:
- Kunden: In der aktuellen Situation nutzen die meisten Anwenderunternehmen keine vergleichbare Lösung. Große Unternehmen nutzen eine Software zur elektronischen Beschaffung und nehmen bei größeren Ausschreibungen Beratungsleistungen in Anspruch. Beides würde weiterhin genutzt, denn das hier dargestellte Konzept ist als Ergänzung zu diesen positioniert. Somit ließen sich keine Kunden von alternativen Angeboten abwerben.
- Kundenbedürfnisse: Primäres Ziel des Konzepts ist die Vereinfachung des Einkaufs von IT-Dienstleistungen. Das IT-Management soll in der Lage sein, diesen Geschäftsprozess mit erheblich weniger Aufwand durchführen zu können. Alle anderen Ziele sind entweder von der Vereinfachung abhängig oder dieser nachgelagert.
- Leistung des Produkts: Im Vergleich zu IT-Sourcing-Beratung und Software zur elektronischen Beschaffung besitzt das Konzept eine geringere Leistungsfähigkeit. Erstgenannte geht individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ein und liefert passgenaue Lösungen. In der Regel beziehen die Unternehmen für die forcierten Aufträge keine Beratungsleistungen, dann ist das Konzept eine erhebliche Verbesserung. Im Vergleich zu Software zur elektronischen Beschaffung soll die Ausschreibungsplattform (vorerst) nur die Funktion eines Online-Marktplatzes übernehmen. Für Unternehmen, die bislang keine solche Software einsetzen, bietet die Ausschreibungsplattform aber eine erhebliche Verbesserung.
- Wettbewerb: Vergleichbare öffentlich verfügbare Dokumentvorlagen sind bislang nicht verfügbar. Sie sind nur mit Beratungsleistungen zusammen einzukaufen. Es existieren verschiedene Anbieterverzeichnisse mit der Auflistung von IT-Dienstleistern, doch sind diese regelmäßig in der Umsetzung mangelhaft. (Siehe nachfolgender Abschnitt.) Unternehmensberatungen unterstützen bei großen Aufträgen den Einkaufsprozess, dabei liegt das Auftragsvolumen regelmäßig im Bereich zweistelliger Millionen Euro. Das dargestellte Konzept ist ausdrücklich nicht für Aufträge dieser Größenordnung konzipiert. Software zur elektronischen Beschaffung kann anstatt der Ausschreibungsplattform zum Einsatz kommen. Bei gleichzeitiger Verwendung der Dokumentvorlagen besteht keine Bedrohung für das Geschäftsmodell. Die Gefahr besteht in einer fehlenden Adoption durch die Marktteilnehmer. Würde das Konzept tatsächlich Erfolg haben, wäre zudem mit Kopien zu rechnen.
- Risiken: Das größte Risiko geht demnach von einer fehlenden oder zu geringen Akzeptanz durch den Markt aus: Wenn der Nutzen nicht verständlich ist oder nicht klar kommuniziert wird, behalten die Anwenderunternehmen die bisherige konventionelle Vorgehensweise bei. Gründe könnten auch sein, dass sie die Nutzung als zu komplex einschätzen oder die IT-Management-Prozesse für einen systematischen Einkauf von IT-Dienstleistungen nicht den erforderlichen Reifegrad besitzen.
Demzufolge handelt es sich bei der Vermittlung von IT-Dienstleistungen um einen neuen Markt. Wenngleich Ansätze zur Unterstützung des Einkaufs von IT-Dienstleistungen existieren, gibt es keine direkten Konkurrenten und somit keine bestehenden Kunden. Ausdruck dessen ist unter anderem, dass es keinen Wettbewerb um Marktanteile geben kann. Damit lassen sich neue Kunden aber auch nicht von Wettbewerbern abwerben.
Folgerichtig ist ein klassischer Vergleich zu Wettbewerbern sind nicht möglich. Damit besteht die größte Herausforderung in der Aufklärung und Information des Marktes über das Konzept.
3.13 Bekannte Implementierungen
Das Konzept des Online-Marktplatzes seit vielen Jahren bekannt. Nachdem die meisten Implementierungen bislang für Konsumenten erfolgten, finden sich seit einigen Jahren auch wieder mehr für Unternehmen.
Die hier entwickelte Adoption auf den Bereich der IT-Dienstleistungen kombiniert verschiedene Elemente. Einzelne Bestandteile finden sich in verschiedenen bekannten Angeboten:
- Research-Dokumente: Neben bekannten Marktforschungsunternehmen wie Gartner und zahlreichen Webseiten mit Technologieschwerpunkt entstehen einige neue Ansätze zur Bewertung von Software: Verschiedene Webseiten bieten einen Überblick über eine hohe Anzahl von Software-Lösungen (Capterra, GetApp, SoftGuide) Andere Webseiten bieten die Möglichkeit der Bewertung von Software, wie sie auch aus dem B2C-Bereich bekannt ist. (G2Crowd, ITQlick)
- Dokumentvorlagen: Architekturen, Leistungsbeschreibungen und andere Dokumente wie Ausschreibungen oder Verträge sind im Web nur sehr wenige verfügbar. Diese scheinen bislang nur unternehmensintern vorzuliegen. Eine systematische Aufbereitung und Veröffentlichung erfolgt bislang nicht.
- Anbieterverzeichnis: Neben den Partnernetzwerken der Hard- und Softwareanbieter (beispielsweise Microsoft Pinpoint) existieren verschiedene Ansätze zur Katalogisierung von IT-Dienstleistern. (co, SoftGuide IT-Dienstleister-Guide)
- Ausschreibungsplattform: Verschiedene andere Angebote haben die Etablierung einer Webanwendung zur Verteilung von Ausschreibungen zum Ziel. Einige legen den Fokus auf nationale IT-Dienstleistungen. (IT-Ausschreibung.de, meine-IT) Die zweite Gruppe richtet sich an Kunden, die IT-Dienstleistungen international vergeben möchten. (IT Exchange, Make IT Deals) Spezielle Lösungen unterstützen bei der Suche und Auswahl eines Dienstleisters zur Entwicklung von Individualsoftware. (plixos, ReqPOOL)
- Ergänzende Dienstleistungen: Verschiedenste Beratungsunternehmen spezialisieren sich auf die Auswahl von Software (INFOSOFT), die Auswahl und Steuerung von IT-Dienstleistern (conaq) oder sehr große Outsourcing-Projekte von Konzernen (ISG).
Die meisten genannten Angebote weisen kein signifikantes Wachstum auf und würden somit nicht in Wettbewerb zu einem neuen Konzept stehen
Eine Bewertung der einzelnen Angebote sprengt den Rahmen dieser Arbeit, besondere Auffälligkeiten sind aber festzuhalten:
- Mehrere Angebote sind nur unzureichend umgesetzt. Dies fällt teilweise schon an der Aufmachung der Webseiten auf. Offensichtlich besteht kein Anspruch, das Angebot weiter zu skalieren. Diese Angebote bestehen teilweise schon seit vielen Jahren, konnten aber über einen kleinen Nutzerkreis nicht hinauswachsen.
- Angebote, die IT-Leistungen international vermitteln wollen, sprechen einen sehr engen Kreis von Anwenderunternehmen ein. Ähnliche kulturelle Begebenheiten und ein geringer Zeitunterschied sind oftmals Voraussetzungen, damit eine internationale Auftragsvergabe auch nur in Betracht gezogen wird. Viele Anwenderunternehmen legen zudem auf eine Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern in geografischer Nähe Wert. Zumindest ist eine Zusammenarbeit über Kontinente hinweg außer bei großen Unternehmen ausgeschlossen.
- Die Etablierung eines Anbieterverzeichnisses oder einer Ausschreibungsplattform erfordert die Anpassung an spezifische Marktbegebenheiten. Viele Angebote scheinen den Markt nicht grundlegend analysiert zu haben. Oftmals berücksichtigt das Geschäftsmodell zudem nicht die spezifischen Implikationen des Netzwerkeffekts: Beispielsweise sind Gebühren für die Listung in einem Anbieterverzeichnis nicht gerechtfertigt, wenn der Nutzen nicht messbar ist.
- Alle bestehenden Angebote unterstützen Anwenderunternehmen nicht bei der schwierigsten Aufgabe: Der Definition der eigenen Anforderungen und der Ausschreibung der Leistung. Wie die Ergebnisse der Befragung zeigen, ist jedoch gerade diese Tätigkeit die mit Abstand komplizierteste. Die Dokumentvorlagen werden insbesondere von der Hauptzielgruppe der größeren Unternehmen als wichtigster Bestandteil betrachtet.
- Einige Angebote zielen zudem auf eine Projektgröße von weniger als 10.000 Euro ab, die von der Hauptzielgruppe praktisch nie ausgeschrieben wird. Auch unterscheidet sich der Beschaffungsprozess von Hard- und Software in wesentlichen Punkten von dem für Dienstleistungen.
- Nach Ansicht des Autors ist die Kombination der verschiedenen Aktivitäten die entscheidende Voraussetzung für einen möglichen Erfolg des hier dargestellten Konzepts. Nur mit der Integration der Elemente erfährt der Einkaufsprozess von IT-Dienstleistungen eine wesentliche Verbesserung.
Eine Analyse der Fehler der bestehenden Konzepte wäre vor einer Umsetzung des hier dargestellten Konzepts unabdingbar, um diese möglichst zu vermeiden. Auch könnte eine Analyse von Online-Marktplätzen im Allgemeinen sinnvoll sein. Ansätze dazu in Form möglicher Weiterentwicklungen befinden sich im letzten Kapitel.
4 Implementierung eines Prototyps
Nach der Analyse der Problematik und der Entwicklung eines Konzepts, erfolgt abschließend die Implementierung in Form eines Prototyps. Diese konzentriert sich auf die Entwicklung einer Webanwendung zur Abbildung des Anbieterverzeichnisses und der Ausschreibungsplattform.
Zwar können beide Elemente rein technisch auch unabhängig voneinander bestehen. Ziel ist aber die möglichst transparente und einfache Aufbereitung der Informationen. Dazu gehört auch, dass die meisten Informationen (dazu zählen neben den Informationen über die IT-Dienstleister auch die Dokumentvorlagen) ohne Anmeldung abrufbar sind. In der Schlussfolgerung stellt das Anbieterverzeichnis Informationen über IT-Dienstleister bereit, auf die die Ausschreibungsplattform zurückgreift.
4.1 Anforderungen an das Anbieterverzeichnis
Das Anbieterverzeichnis soll einen möglichst umfassenden Überblick über die am Markt aktiven IT-Dienstleister geben. Es existieren zwei grundlegende Möglichkeiten zur Darstellung: Die erste Möglichkeit besteht in einer Suche und darauf folgenden Ergebnisliste. Die zweite Möglichkeit ist die Anzeige des vollständigen Datenbestands, wobei Filter eine Eingrenzung ermöglichen. Die Filterkriterien sollen dabei zwar möglichst einfach die Ergebnisliste reduzieren, auf der anderen Seite aber möglicherweise passende Anbieter nicht unterschlagen. Vorteil bei letzterer Darstellung ist, dass das Verfahren transparenter und besser nachvollziehbar ist. Doch müsste der Nachteil in Kauf genommen werden, dass die Daten einfach zu kopieren sind. Das Verzeichnis wäre in diesem Fall kein proprietäres Gut mehr. Nach dem Test der beiden Möglichkeiten zur Darstellung erfolgt die Implementierung der zweiten.
Wenn die IT-Dienstleister ihr Profil selber pflegen sollen, müssen die Kriterien für einzelne Merkmale möglichst genau definiert sein. Da über das Konzept Kunden geworben werden sollen, könnte wie bei ähnlichen Angeboten schnell das Bedürfnis entstehen, allen Anforderungen zu genügen, um für möglichst viele mögliche Kunden attraktiv zu erscheinen. Die Anwenderunternehmen wollen aber gerade nicht das Ziel (den Wunsch) der IT-Dienstleister abgebildet haben, sondern die aktuelle Realität.
Im Detail sind verschiedene Filterkriterien möglich:
- Anbietername: Eigentlich selbsterklärend, doch in manchen Fällen unterscheidet sich die Marke von der Firma. Insbesondere aufgrund der in Deutschland geltenden Impressumpflicht wäre hier eine Klarstellung notwendig.
- Standorte: Eine Liste von Staaten, Bundesländern und Regionen, in denen das Unternehmen ein Büro besitzt. Dies ist insbesondere für Managed-Services im Bereich der IT-Infrastruktur relevant.
- Aktivitäten: Hier wäre zwischen klassischen IT-Dienstleistungen (Implementierung und Managed-Services), IT-Management-Beratung, Training (Schulungen) und die Entwicklung von Individualsoftware zu unterscheiden. Weitere Klassen könnten mit der Erweiterung des Anbieterverzeichnisses hinzukommen.
- Unterstützte Hard- und Softwareanbieter (Partner): IT-Dienstleister bauen ihr Portfolio in der Regel um die Lösungen einer Reihe von Hard- und Softwareanbietern. Wie oben dargestellt entscheiden sich Anwenderunternehmen normalerweise zuerst für eine Technologie und suchen im Anschluss einen IT-Dienstleister für die Implementierung dieser.
- Partnerkompetenzen: Einige Hard- und Softwareanbieter besitzen ein sehr umfangreiches Portfolio unterschiedlicher Lösungen. Dazu erweitern diese Anbieter ihr Partnerprogramm um verschiedene Kompetenzen, die von den Partnern erlangt werden können. Letztendlich bilden diese Kompetenzen die unterschiedlichen Lösungen ab. Bekannt ist dieses System insbesondere von Microsoft und VMware.
- Unternehmensgröße: Um einen passenden IT-Dienstleister zu finden, ist auch dessen Größe relevant. Viele IT-Leiter wünschen sich einen IT-Dienstleister auf Augenhöhe, um als Kunde adäquat bedient zu werden.
- Zielmarkt (Kundengröße): IT-Dienstleister besitzen in der Regel eine Kundenzielgruppe. Diese lässt sich regelmäßig nach Branchen und Unternehmensgröße differenzieren. Einige kleinere IT-Dienstleister bedienen teilweise auch sehr große Unternehmen.
Viele befragte IT-Leiter geben an, dass sie sich eine vergleichbare Darstellung von Projektreferenzen wünschen. Referenzen in Form von Fallstudien wären das einzige Kriterium, welches tatsächlich Aussagekraft besäße. Im Gegensatz dazu sind allgemein gehaltene, selbstbeschreibende Texte auf den Webseiten der IT-Dienstleister für viele IT-Leiter nicht nützlich.
Die Fallstudien sollten dabei ebenfalls durchsuchbar sein. So lässt sich über die Suche nach Fallstudien auf IT-Dienstleister schließen. Jene besitzen prinzipiell dieselben Kategorien zur Einordnung, wobei sich die Werte dabei jeweils auf das Projekt beziehen.
Für die Kategorisierung von IT-Management-Beratung kommt ein weiteres Merkmal hinzu:
- Management-Prozesse: In der IT-Management-Beratung geht es oftmals um die Etablierung und Optimierung von Prozessen der IT-Organisation. Das System aus Anbietern und Kompetenzen ist dafür nicht praktikabel. Projekte lassen sich aber anhand der bearbeiteten (verbesserten) IT-Management-Prozesse klassifizieren.
Alles in allem sind die aufgezählten Merkmale ein erster Schritt zur Systematisierung von IT-Dienstleistern und Fallstudien. Anwenderunternehmen und IT-Dienstleister wären angehalten, Vorschläge für weitere zu unterbreiten.
4.2 Anforderungen an die Ausschreibungsplattform
Ziel der Ausschreibungsplattform ist eine Prozessverbesserung bei der Ausschreibung von IT-Dienstleistungen. Das IT-Management der Anwenderunternehmen soll ermächtigt werden, durch einen geführten und intuitiven Prozess den Ausschreibungsprozess zu steuern. Wichtigstes Ziel ist, den Aufwand einer Ausschreibung von der Anzahl der Empfänger zu lösen. Nur dann lässt sie sich an eine möglichst hohe Anzahl von IT-Dienstleistern verteilen.
Die Ausschreibungsplattform soll vier wesentliche Funktionen abdecken:
- Verteilung von Ausschreibungen: Die Plattform verteilt die Ausschreibung an vorher ausgewählte IT-Dienstleister. Alternativ definiert das Anwenderunternehmen bestimmte Kriterien, auf deren Basis die Auswahl der IT-Dienstleister automatisch vorgenommen wird.
- Stellen von Rückfragen: Die Empfänger der Ausschreibung haben in der Regel Rückfragen zu dieser. Der konventionelle Kontakt zum Anwenderunternehmen per E-Mail und Telefon soll im Sinne der Prozessteuerung unbedingt vermieden werden. Somit ist eine Funktion notwendig, Rückfragen zu einer Ausschreibung einzureichen.
- Beantwortung der Rückfragen: Die Klärung der Rückfragen ist notwendig, damit die IT-Dienstleister einen adäquaten Vorschlag einbringen können. Da andere IT-Dienstleister unter Umständen ähnliche Fragen haben oder die Antwort auch ohne explizite Frage hilfreich sein könnte, wäre eine direkte Beantwortung der Rückfragen nur eingeschränkt nützlich, beziehungsweise würde den Prozess nicht signifikant verbessern. Vielmehr sollten die Antworten der Rückfragen allen teilnehmenden IT-Dienstleistern in einem Schritt zur Verfügung gestellt werden.
- Einreichen eines Vorschlags: Nachdem alle Rückfragen beantwortet sind, stellen die Empfänger der Ausschreibung (IT-Dienstleister) einen Vorschlag ein.
Die Ausschreibungsplattform ist grundsätzlich an konsumentenorientierte Online-Marktplätze angelehnt. Sie unterscheidet sich aber in wesentlichen Aspekten von diesen. Im Vergleich zu Angeboten für den Handel von Gütern, sind komplexe Projekte immer individuell. Dies macht es erforderlich, eine Ausschreibung als initialen Schritt zu nutzen. Ähnlich ist dieses Vorgehen aber auch bei Investitionsgütern: Bei anderen B2B-Gütern findet sich heutzutage eine Mischung in Form einer vorkonfigurierten, automatisiert zu erstellenden Ausschreibung. Die Dokumentvorlagen und vor allem spätere Weiterentwicklungen (siehe entsprechender Abschnitt) sollen den Weg dahin einschlagen.
Die Ausschreibungsplattform sollte langfristig eine Vielzahl funktioneller Erweiterungen erhalten. Dazu gehören insbesondere einzelne Prozesse bekannter IT-Management-Frameworks. Dies ist auch im Sinne einer langfristigen Bindung der Kunden an die Plattform zu forcieren. Themen sind dabei das Provider-Management mit einer Vertragsverwaltung.
Für die Implementierung des Prototyps wird sich auf die grundlegenden Funktionalitäten beschränkt. Insbesondere soll dargestellt werden, wie die Verteilung von Ausschreibungen und die Beantwortung von Rückfragen erfolgt.
4.3 Vorgehensweise
Mittlerweile wird neue Software praktisch nur noch als Webanwendung in der Cloud konzipiert. Die Ausschreibungsplattform ist die logische Erweiterung des Anbieterverzeichnisses. Sie ist mindestens auf dessen Datenbestand angewiesen. Insofern erfolgt eine Implementierung auf Grundlage einer Webanwendung für beide Bestandteile.
Die technischen Details der Implementierung sind nicht Gegenstand der Arbeit. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen sogenannten Demonstrator. Ein anderer Begriff ist das Minimum viable product (MVP). Der Unterschied zu einer Beta-Version ist, dass der Demonstrator nicht dafür gedacht ist, irgendwann in den Live-Betrieb zu gehen. Es ist von Beginn an vorgesehen, dass er durch ein anderes System ersetzt wird. (In der Softwareentwicklung werden dafür häufig auch sogenannte Mock-ups, Zeichnungen der Bedienoberfläche, genutzt.)
Um die Anwendung zu veranschaulichen, sind einige Testdaten eingefügt. Diese stammen aus öffentlichen Verzeichnissen und Unternehmenswebseiten und entstammen somit von real existierenden Unternehmen. Sie stehen in keinerlei Zusammenhang mit den durchgeführten Interviews.
Die Webanwendung ist auf eine Bildschirmauflösung von 1600x900 Pixel ausgelegt. (Diese ist häufig bei aktuellen Notebooks für Geschäftskunden verbaut.) Aufgrund der Einbindung in diese Arbeit sind die die nachfolgenden Bildschirmfotos (Screenshots) mit einer Auflösung von 1024x768 aufgenommen, woraus etwaige leichte Verschiebungen des Layouts resultieren.
4.4 Implementierung des Anbieterverzeichnisses
Das Anbieterverzeichnis besteht in der Übersicht aus einer Liste von IT-Dienstleistern. Die Ansicht zeigt den Namen, die Standorte in Form von Staaten und Regionen, Aktivitäten, Partner in Form von Soft- und Hardwareanbietern und Partnerkompetenzen. Ergänzend dazu noch Unternehmensgröße und Kundenzielgruppe (nicht auf dem Bildschirmfoto zu sehen).
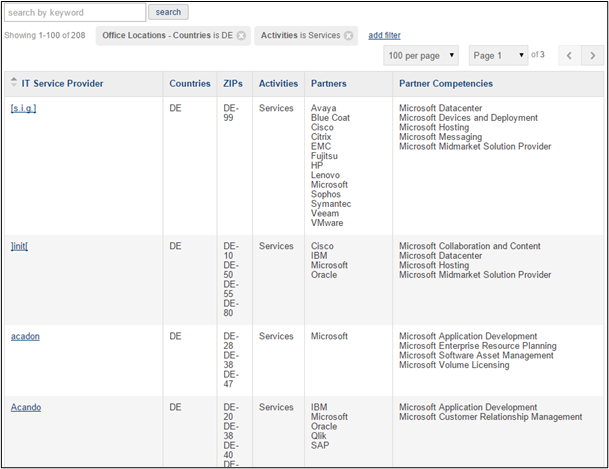
Abbildung 4: Gefilterte Liste der verzeichneten IT-Dienstleister
Abbildung 4 zeigt diese Sicht. Ziel ist, sich auf einfache Weise einen Überblick über die verschiedenen Eigenschaften und Kompetenzen verschaffen zu können. Anwenderunternehmen sollen mit einem Blick erkennen, welche IT-Dienstleister für eine genauere Begutachtung in Frage kommen.
Oberhalb der Liste lassen sich Filter setzen. Diese ermöglichen eine Filterung auf Basis der Spalten, was eine Kürzung der Liste zur Folge hat. Damit reduziert sie sich im Idealfall auf einen handhabbaren Umfang von circa 20 bis 50 Einträgen. Diese Vorauswahl ist für das Anwenderunternehmen die Grundlage einer genaueren Analyse der IT-Dienstleister.
Die detaillierten Informationen zu einem IT-Dienstleister finden sich mit Klick auf den Namen dessen. Sie enthalten die im vorherigen Abschnitt ausgeführten Informationen und eine Beschreibung. (Grafisch ähnlich aufbereitet, wie die Detailansicht einer Fallstudie; siehe weiter unten.) Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Auflistung der dazugehörigen Fallstudien. Die Profile inklusive der Fallstudien würden von den IT-Dienstleistern selber gepflegt werden, um so den Aufwand auf Seiten des Anbieters des Konzepts zu reduzieren.
Die Referenzen in Form von Fallstudien stellen jeweils ein einzelnes Projekt oder einen Auftrag für einen Managed-Service dar. Die Fallstudie entspricht der Kundenbewertung eines Produkts, Herstellers oder Händlers auf konsumentenorientierten Online-Marktplätzen.

Abbildung 5: Detailansicht einer Fallstudie
Abbildung 5 zeigt die Detailansicht einer Fallstudie. Die Beschreibung ist in die Bereiche Grundlagen, Kunde und die Beschreibung des Projekts unterteilt. Hier ist die Angabe eindeutiger Merkmale, wie Hard- und Softwareanbieter und Angaben über den Kunden wichtig. Mit diesen Daten lassen sich die Fallstudien, wie die Liste der IT-Dienstleister, durchsuchen. Die Liste der Fallstudien ist die gleiche wie die der IT-Dienstleister. (Keine Abbildung vorhanden.) Sie bietet analog die Filterung nach bestimmten Merkmalen, als auch eine Volltextsuche. Somit werden IT-Dienstleister auch über die hinterlegten Fallstudien und damit die in der Vergangenheit durchgeführten Projekte gefunden. Dies ist ein wesentliches Merkmal, welches in den bestehenden Partnernetzwerken bislang nicht berücksichtigt ist.
4.5 Implementierung der Ausschreibungsplattform
Die Ausschreibungsplattform dient der Abwicklung des Ausschreibungsprozesses für IT-Dienstleistungen. Wichtigstes Ziel ist die Entkopplung des Aufwands der Ausschreibung von der Anzahl der Empfänger.
Seitens der befragten IT-Leiter ist vielfach eine möglichst feingranulare Steuerung der Verteilung gewünscht. In diesem Demonstrator nicht implementiert ist die Möglichkeit der Verteilung der Ausschreibung an eine Gruppe von IT-Dienstleistern, die auf Basis bestimmter Parameter ausgewählt wird. Die manuelle Auswahl der Empfänger ist zudem der sicherste Weg zur Vermeidung von Bedenken bezüglich des Datenschutzes.

Abbildung 6: Liste der Teilvorgänge einer Ausschreibung
Die Detailansicht einer Ausschreibung ähnelt der einer Fallstudie. Wie in Abbildung 6 dargestellt, findet sich unterhalb dieser Beschreibung eine Übersicht über die zu der Ausschreibung gehörenden Rückfragen (Feedback) der IT-Dienstleister, der Ergänzungen (Amendments) des Anwenderunternehmens und der abgegebenen Vorschläge (Proposals) der IT-Dienstleister. Die Detailansichten dieser Einträge (ohne Abbildung) bestehen nur aus einem Textfeld und einem Dateianhang und sind damit ähnlich aufgebaut wie die Ansicht der Fallstudien (Abbildung 5).
Ausschreibungen sind einem Anwenderunternehmen und mindestens einem IT-Dienstleister zugeordnet. Das Feedback besitzt wiederum eine 1:1-Verknüpfung. Hintergrund ist, dass nicht immer gewollt ist, dass die Rückfragen (wie bei konsumentenorientierten Online-Marktplätzen) von anderen IT-Dienstleistern eingesehen werden können. Die Ergänzungen sind von allen an der jeweiligen Ausschreibung teilnehmenden IT-Dienstleistern einzusehen. Wenn die Beantwortung der Rückfrage privat und nicht über eine Ergänzung der Ausschreibung erfolgen soll, kann dies per E-Mail oder über eine später zu implementierende Nachrichten-Funktion erfolgen. Die Vorschläge stammen wie die Rückfragen von den einzelnen IT-Dienstleistern und sind nur von diesem und dem Anwenderunternehmen einsehbar.
4.6 Ausblick
Obgleich es sich um einen Prototyp mit einem rudimentären Funktionsumfang handelt, ist eine Vielzahl konzeptioneller Überlegungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der Webanwendung müsste in enger Abstimmung mit ersten Pilotkunden oder Beta-Testern erfolgen.
Bei einer Umsetzung des Konzepts, ergeben sich eine Reihe weiterer Anforderungen:
- Detaillierte Filtermöglichkeiten: Mit einer steigenden Anzahl von IT-Dienstleistern oder der Ausweitung auf andere Tätigkeitsschwerpunkte in der IT müssten zusätzliche Filter hinzugefügt werden. Nur so lässt sich weiterhin die Anzahl der Ergebnisse auf eine handhabbare Anzahl verringern. Alternativ könnte man Erweiterungen ausgründen, also eine eigene Webanwendung veröffentlichen. Dies ist aber insofern schwierig, als dass sich die Tätigkeiten innerhalb der Branche stark überschneiden.
- Compliance: Mit einem tatsächlichen Betrieb müssten diverse Regelungen zur Nachverfolgung von Geschäftsprozessen eingehalten werden. Die Informationen müssten sich rechts- und revisionssicher verwahren lassen.
- Nachrichten: Wichtig wäre zudem eine Möglichkeit zum Austausch von Nachrichten, sodass die Benutzer weitestgehend auf E-Mails verzichten können. Vorteil dabei wäre, dass der Beschaffungsprozess auf einer Plattform gebündelt würde.
- Community: Auch Funktionen eines sozialen Netzwerks wären sinnvoll, beispielsweise für die Kommunikation zwischen IT-Leitern. Bisherige soziale Netzwerke berücksichtigen oftmals nicht branchen- oder funktionsspezifische Begebenheiten.
- Provider-Management: Die Webanwendung ließe sich inkrementell für das Management verschiedener IT-Dienstleister erweitern. Wettbewerb zu bestehenden Lösungen, beispielsweise für das IT-Service-Management, wäre aber unbedingt zu vermeiden.
5 Abschluss
Abschließend erfolgt eine Einordnung in bekannte Muster für Innovationen und erste Ansätze einer möglichen Weiterentwicklung des Konzepts. Einer der wichtigsten Bestandteile der eingangs vorgestellten Frameworks ist die stete Weiterentwicklung und Veränderung der Idee. Das kann so weit gehen, dass nach einer sogenannten Pivotierung, ein gänzlich anderes Angebot entsteht.
5.1 Innovation
Grundsätzlich basieren die meisten Geschäftsmodelle auf einer Reihe bekannter Konzepte, welche sich verschieden klassifizieren lassen. An dieser Stelle soll eine erste Einordnung erfolgen. Nach Keely et al. (2013) ist ein Konzept umso vielversprechender, umso mehr Innovationsmuster Beachtung finden.
Das dargestellte Konzept hat den Austausch zum Ziel und ist damit plattformgetrieben:
- Zentrales Element ist die Vermittlung von Aufträgen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Nur bei Verwendung nutzergenerierter Inhalte kann der Austausch funktionieren und insbesondere auch die Dokumentvorlagen weiterentwickelt werden. Die Benutzergemeinschaft ist verantwortlich für die gegenseitige Erbringung der Dienstleistungen und somit selber Treiber des Angebots.
Darüber hinaus prägen weitere Innovationen das Konzept:
- Geschäftsmodell: Bei der Abgabe von Vorschlägen spielt auch der veranschlagte Preis eine wesentliche Rolle bei der Auftragsvergabe. Der Preis wird auch durch eine Auktion Die Dokumentvorlagen und damit ein wesentlicher Teil des Konzepts sind kostenlos. Es handelt sich somit um ein FreemiumAngebot. Mit der Provision zahlen Marktteilnehmer immer entsprechend des Auftragsvolumens und somit nur für die abgenommene Leistung (Metered Use).
- Netzwerk: Das Angebot der ergänzenden Aktivitäten in Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratungsunternehmen ist eine ergänzende Partnerschaft. Die Zusammenarbeit von IT-Dienstleistern, Anwenderunternehmen und Hard- und Softwareanbietern bei der Anfertigung und Weiterentwicklung der Dokumentvorlagen ist eine Form der Open Innovation. Ein Zweitmarkt ermöglicht die Nutzung der hochgeladenen Ausschreibungen zur Verbesserung der Dokumentvorlagen und damit zukünftiger Ausschreibungen anderer Anwenderunternehmen.
- Prozess: Wesentliches Ziel der Ausschreibungsplattform ist die Prozessautomatisierung von Ausschreibungen. Mit der Entkopplung des Aufwands einer Ausschreibung von der Anzahl der Ausschreibungsempfänger steigt auch die Prozesseffizienz. Mit der Ausschreibungsplattform, den Dokumentvorlagen und Best-Practices im Umgang mit beiden erfolgt zudem eine Prozessstandardisierung.
- Produktleistung: Ziel aller Aktivitäten ist die Steigerung der Benutzerfreundlichkeit im Umgang mit IT-Ausschreibungen. Wie im Abschnitt über die bekannten Implementierungen gezeigt, handelt es sich um eine Kombination verschiedener bestehender Ansätze, was Ausdruck einer Funktionsaggregation Im Vergleich zu bekannten Online-Marktplätzen, insbesondere auch im Bereich der B2B-Dienstleistungen, liegt der Fokus auf standardisierbare IT-Dienstleistungen. Ansprechpartner ist der IT-Leiter beziehungsweise leitende IT-Mitarbeiter.
- Produktsystem: Die einzelnen Bestandteile sind als modulares System aufgebaut, sodass sie sich auch unabhängig voneinander nutzen lassen.
- Service: Das Konzept in Form eines Webangebots und nicht als Beratungsleistung spiegelt das Prinzip der Selbstbedienung Anwenderunternehmen erhalten die nötigen Mittel, um selber aktiv zu werden. Darüber hinaus erfolgt mit den ergänzenden Aktivitäten eine weitergehende Unterstützung der Anwenderunternehmen bei Leistungen, die diese nicht selber erbringen wollen oder können. Darunter fallen insbesondere das Anforderungsmanagement und die Anfertigung von Ausschreibungen. (Concierge). Diese Zusatzdienste erbringen besonders am Anfang Partner.
- Marke: Das Konzept soll den Markt vereinfachen, muss dabei aber selber ein hohes Maß an Transparenz Die grundlegenden Aktivitäten müssen besonders von den ergänzenden Aktivitäten abgegrenzt werden.
- Kundenbindung: Oberstes Ziel ist die Vereinfachung der Erfahrung des Einkaufs von IT-Dienstleistungen durch die Reduzierung von Komplexität. Dies ist auch das Hauptargument bei der Kundenbindung und Weiterempfehlung an andere Kunden.
Wenngleich einige Muster sehr ähnlich zu sein scheinen und andere selbstverständlich sind: Für den Bereich IT-Dienstleistungen bringen diese und insbesondere die Kombination ein hohes Maß an Innovation mit sich. Das unterscheidet das Konzept auch von den vorgestellten bekannten Implementierungen.
5.2 Weiterentwicklung
Die schnelle technische Entwicklung in der Informationstechnologie fordert viele Unternehmen. Insbesondere die Integration verschiedener Systeme und die Migration auf neue Versionen nehmen weiterhin einen Großteil der Kapazitäten von IT-Organisationen ein. Diese sollten sich jedoch vielmehr der Entwicklung wertschöpfender Informationstechnologie als Teil der eigenen Produkte widmen.
Nach Jahren immer komplexer werdender IT-Landschaften, tritt anstelle von Faktoren wie Geschwindigkeit, Preis oder Leistung das Argument der Vereinfachung. Diese ermöglicht Unternehmen eine Konzentration auf ihre Kernkompetenzen und lässt IT-Mitarbeiter früher nach Hause gehen. Erkennbar ist dieser Trend an der Umstellung zahlreicher Anwendungen auf Cloud-Lösungen. Bei diesen sinkt der Aufwand der Administration dramatisch. Aber auch im Bereich der IT-Infrastruktur erfinden disruptive Anbieter bekannte Technologien neu. Nach Meinung des Autors wird sich der Trend zur Vereinfachung in den nächsten Jahren nicht nur in der IT, sondern in allen Branchen massiv verstärken. Online-Marktplätze und darauf aufbauende Angebote zum Einkauf von Leistungen auf Abruf (on-demand) sind dabei ein wesentlicher Bestandteil dieser Vereinfachung.
Angelehnt an die Klassifizierung von Galston (2015) ist die folgende Betrachtung von Online-Marktplätzen aber differenzierter:
- Güter - Dienstleistungen - Humanressourcen - andere Ressourcen: Es können Güter, Dienstleistungen oder Personal vermittelt werden. Darüber hinaus aber auch andere Ressourcen, wie beispielsweise Kapazitäten in der Produktion oder Logistik.
- Kaufen - Mieten: Güter lassen sich verkaufen oder vermieten. Bei Dienstleistungen oder Personal kann man zwischen einem lang- oder kurzfristigen Engagement Der Trend zur Vermietung von Gütern und Ressourcen wird auch als Sharing economy bezeichnet.
- Ein Angebot - Aggregation von Angeboten: Eine Plattform kann eine Leistung unter eigenem Namen selber anbieten. Verschiedene Vertragspartner erbringen diese dann als selbständige Unternehmer im Auftrag der Plattform. (Wenn sie durch den Plattformanbieter selber erbracht würde, wäre es keine Plattform beziehungsweise kein Marktplatz.) Alternativ bietet die Plattform eine Übersicht (Aggregation) über am Markt agierende Leistungserbringer, welche sich individuell beauftragen lassen.
- Einzelne Leistungserbringer - Kollaboration verschiedener Leistungserbringer: Klassisch erfolgt die Leistungserbringung durch einen Vertragspartner (Individuum oder Unternehmen). Wenn mehrere Akteure, vor allem einzelne Personen, an der Erbringung der Leistung beteiligt sind, wird dies auch als Crowdsourcing bezeichnet.
- Unternehmen - Einzelne Personen: Leistungen werden entweder durch Unternehmen und damit eine Gruppe von Personen in einer festen Organisation oder durch Individuen, also freie Mitarbeiter erbracht. Auch können Unternehmen mit einzelnen Personen zusammenarbeiten.
- Verhandlungen - Auf Abruf: Leistungen lassen sich einerseits nach mehr oder weniger intensiven vorausgehenden Verhandlungen erbringen. Der Trend geht aber zur vergleichsweise spontanen Erbringung von Leistungen auf Abruf. Der Anbieter standardisiert dabei das Angebot so, dass der Vertrieb hochgradig automatisiert geschieht. Gleichwohl wollen die Kunden aber ihre individuellen Ansprüche erfüllt sehen.
Das Konzept (hier die Ausschreibungsplattform in Verbindung mit dem Anbieterverzeichnis) vermittelt Dienstleistungen, welche tendenziell langfristig (zumindest über mehrere Wochen) erbracht werden. Dabei handelt es sich um eine Aggregation von Angeboten auf einer Plattform, auf der Unternehmen als einzelne Leistungserbringer auftreten. Die Leistungserbringung erfolgt nach Verhandlungen in Form eines Ausschreibungsprozesses.
Obgleich bereits das in dieser Arbeit dargestellte Konzept erhebliche Verbesserungen für die Marktteilnehmer bringen würde, sind auch Weiterentwicklungen denkbar. Übergreifendes Ziel bleibt die Vereinfachung von IT.
Anhand des oben entwickelten Schemas sind verschiedene Erweiterungen beziehungsweise Änderungen des Konzepts möglich:
- Güter, Humanressourcen: Neben dem Vertrieb von IT-Dienstleistungen ist auch der Vertrieb von Hard- und Software denkbar. Dabei formuliert ein Anwenderunternehmen seinen Bedarf, woraufhin Anbieter ihr Produkt auf einigen Seiten vorstellen dabei auf die spezifischen Bedürfnisse des Einkäufers eingehen. Diese Vorgehensweise vereinfacht den Prozess der Recherche. Angebote zur Vermittlung von Personal existieren bereits zahlreiche. (Siehe unten)
- Kurzfristiges Engagement: Neben Implementierungsprojekten mehrerer Wochen oder Managed-Services besteht bei sehr großen Unternehmen teilweise der Bedarf nach sehr kurzfristigen Lösungen, insbesondere beim Einkauf von freien Mitarbeitern. Ein Beispiel wäre der Einsatz mehrerer Systemadministratoren im Rahmen einer Migration oder eines Rollouts.
- Ein Angebot: Insbesondere Managed-Services und die Implementierung von Cloud-Lösungen sind standardisierbare Tätigkeiten. Dieses Angebot wäre insbesondere für den gehobenen Mittelstand mit 100 bis 1000 Mitarbeitern interessant. Es wäre die Schlussfolgerung aus der Commoditisierung und damit Ausdruck der Vollendung der IT-Fabrik: Dienstleistungen werden dabei als Produkte angeboten. (Auch bekannt als Service-as-a-Software.)
- Kollaboration verschiedener Leistungserbringer: Es sind auch Möglichkeiten des Crowdsourcing im Bereich der IT-Dienstleistungen denkbar: Beispielsweise die Anfertigung von Architekturen und Leistungsbeschreibungen könnte gemeinsam in der Gruppe erfolgen.
- Einzelne Personen: Konzepte zur Vermittlung von Aufträgen zwischen Unternehmen sind bislang eher selten. Dagegen existiert eine Vielzahl von Online-Marktplätzen für die Vermittlung freier Mitarbeiter. Studien gehen davon aus, dass in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 circa 50% der Arbeitnehmer freie Mitarbeiter sein werden. (Der Trend dürfte mit einiger zeitlicher Verzögerung auch nach Europa kommen.) Insofern wäre eine Weiterentwicklung auf diesen Bereich unbedingt zu forcieren. Eine Möglichkeit wäre die Zusammenstellung virtueller Teams für Implementierungsprojekte und Managed-Services. Diese könnten im Gegensatz zu üblichen freien Mitarbeitern auf Stundenbasis verlässlichere Leistungen auf langfristiger Basis erbringen. Unbedingt erforderlich wäre eine Abgrenzung zu existierenden Online-Marktplätzen. (Freelancers Union & Elance-oDesk 2015)
- Auf Abruf: Die Steigerung des unter einer Marke konzentrierten Angebots ist die Erbringung von Leistungen auf Abruf. Dabei könnten IT-Dienstleister oder die dargestellten virtuellen Teams das Angebot mit sehr geringer Vorlaufzeit erbringen. Zu den möglichen Leistungen zählen insbesondere solche aus dem Bereich der IT-Infrastruktur und Migrationen auf Cloud-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen mit zehn bis 100 Mitarbeitern. Bei dieser Leistungserbringung auf Abruf spielt weniger die technische Umsetzung, sondern vielmehr eine stringente Prozessorientierung und vor allem eine Änderung der inneren Einstellung zu IT-Dienstleistungen eine Rolle.
Neben den dargestellten Erweiterungen sind Trends wie Data-Analytics zu adoptieren. Beispielsweise ließen sich die anfallenden Datensätze der Aufträge systematisch auswerten. Im Vergleich zu heutzutage teuer einzukaufendem IT-Benchmarking wäre die Datenbasis zudem ungemein größer und damit aussagekräftiger.
Das Konzept ließe sich eventuell auch auf verschiedene andere sogenannte Professional Services ausdehnen. Dazu zählen beispielsweise der Bereich Marketing-, PR- und Werbung. Wichtig ist dabei die genaue Adaptierung an die Erfordernisse des jeweiligen Marktes.
5.3 Potenzial und Ausblick
Obgleich diese Untersuchung eine empirische Komponente beinhaltet, handelt es sich um ein Konzept. Dieser Umstand ist auch beim Vergleich zu bestehenden Angeboten und anderen Online-Marktplätzen zu berücksichtigen.
Es bleiben verschiedene Risiken bestehen:
- IT-Dienstleistungen sind mitunter sehr komplex. Verschiedene Gesprächspartner äußerten sich kritisch aufgrund der schwierigen Vergleichbarkeit. Insbesondere die Integration unterschiedlicher Systeme in komplexe IT-Landschaften ist mitunter eine Aufgabe über Monate. Zu beantworten bleibt, ob für diese Tätigkeiten ein Online-Marktplatz der geeignete Weg zur Geschäftsanbahnung ist. Zudem muss sich der Geschäftsprozess weitgehend standardisieren lassen.
- Abzuwarten bliebe zudem die Adoption durch den Markt. Viele IT-Organisationen sind neuen Konzepten gegenüber relativ konservativ eingestellt. Die IT ist häufig mit der Erbringung von Standardleistungen beschäftigt und widmet ihr Augenmerk nur in wenigen Fällen der Transformation der IT zu einem Wertträger für das Unternehmen. Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in der inneren Einstellung der IT-Mitarbeiter wieder, was die Verbreitung neuer innovativer Konzepte verhindern könnte. Eine Adoption durch den Markt setzt aber zwingend die Aufgeschlossenheit der Marktteilnehmer gegenüber neuen Ansätzen voraus.
- Wenn auch nicht in so sehr in Deutschland, ist doch ein deutlicher Trend in Richtung Cloud-Lösungen zu erkennen. Diese benötigen erheblich geringere Ressourcen in der Einführung und minimale in der laufenden Wartung. Der Markt für IT-Dienstleistungen wird sich aufgrund dessen in den nächsten Jahren weiter massiv verändern. Dabei nehmen Beratung zur Transformation des Geschäfts und die Entwicklung von wertschöpfender IT als Bestandteil der Produkte einen deutlich größeren Raum ein. Reine Implementierungsprojekte dürften in der Anzahl abnehmen. Komplexe strategische Beratungsprojekte sind jedoch deutlich schwieriger zu standardisieren, was aber Voraussetzung für die Vermittlung über einen Online-Marktplatz ist.
- Der Arbeitsmarkt verändert sich weiterhin in hohem Tempo: Insbesondere der steigende Anteil freier Mitarbeiter ermöglicht Unternehmen den schnellen Einkauf von Personal, auch für einen kurzen Zeitraum. Kritiker bemängeln, dass dies eine Teilung der Arbeitnehmerschaft in eine sehr gut verdienende Elite und das sogenannte digitale Prekariat zur Folge hat. Der Trend zu einem hohen Anteil freier Mitarbeiter auf Projektbasis bedroht das ausgearbeitete Konzept nur mittelbar: Zum einen ist die Entwicklung derzeit nicht abzusehen, zum anderen ließe sich das Konzept wie zuvor dargestellt bei Veränderungen des Marktes anpassen.
Dagegen stehen verschiedene Chancen:
- Bei den zu vermittelnden IT-Dienstleistungen handelt es sich vielfach um Leistungen rund um Standardsoftware und IT-Infrastruktur. Im Vergleich zu wertsteigender IT als Produktbestandteil sind diese Themen weder etwas neues, noch besonders spannend in der Umsetzung. Doch wie der empirische Teil dieser Arbeit zeigt, beanspruchen diese Themen einen Großteil der Kapazitäten der IT-Organisationen der Anwenderunternehmen. Hinzu kommt, dass obgleich sich viele dieser Leistungen standardisieren und vereinfachen lassen, diese dennoch eingeführt, gepflegt und unter Umständen auch wieder ersetzt werden müssen.
- Der Markt für IT-Projekte und -Outsourcing wächst prozentual zwar nur im einstelligen Bereich, doch ist und bleibt er damit ein Milliardenmarkt. Betrachtet man wie oben ausgeführt zusätzlich den Markt für freie Mitarbeiter, ist weiterhin ein deutlicher Trend zur Verlagerung an externe Kräfte zu beobachten. Zudem werden nur wenige einmal ausgelagerte Leistungen wieder zurück ins Unternehmen geholt.
- Wichtig ist zudem die Betrachtung anderer Märkte: Wie Galston (2015) ausführt, handelt es sich bei vielen anderen Online-Marktplätzen ebenfalls um vergleichsweise alte Märkte, die aber ein Milliardenvolumen besitzen. Ob Büromanagement, Call-Center oder Hausmeisterdienste: Neue Konzepte und Herangehensweisen können viele Märkte fundamental neu ordnen. Der Wunsch sich auf seine Kernkompetenzen zu beschränken und ergänzende Leistungen einfach, schnell und flexibel extern einzukaufen ist ein übergeordneter Trend, welcher allen Marktteilnehmern und der Gesellschaft insgesamt zugutekommt.
- In der IT nimmt das Cloud-Computing dabei eine Schlüsselrolle ein: Zum einen basiert dieses auf der Vereinfachung der Leistungen und der Bereitstellung auf Abruf. Ebenso wichtig ist aber die vereinfachte Administration der Lösungen: Durch den vollständigen Wegfall eigener Komponenten, lassen sich Cloud-Lösungen mit deutlich geringerem Aufwand verwalten. Die Fortführung der Bereitstellung der Lösungen auf Abruf ist die Administration dieser auf Abruf.
- Voraussetzung für einen strukturellen Wandel hin zu einem vereinfachten Ausschreibungsprozess ist die Aufgeschlossenheit der Marktteilnehmer. Wie sich an der Befragung zeigt, stehen zumindest die Anwenderunternehmen dem Konzept aufgeschlossen gegenüber. Einige zusätzliche Interviews mit IT-Dienstleistern, wenngleich nicht systematisch durchgeführt, zeigen zudem ebenfalls eine positive Grundeinstellung. Letztendlich dürfte die Marktmacht der Einkäufer hier aber einen wesentlichen Beitrag zur Überzeugung leisten.
Während Politik und Wirtschaft praktisch täglich von der Notwendigkeit zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sprechen, ist diese Domäne innerhalb der Betriebswirtschaft immer noch auf der Meta-Ebene behaftet. Dabei werden vor allem Modelle und Vorgehensweisen untersucht. Der systematische Vergleich von Geschäftsmodellen oder gar wie in dieser Arbeit die Entwicklung neuer Konzepte genügt nach Meinung vieler nicht akademischen Ansprüchen. So bleibt die Forschung in diesem Bereich entweder aus oder dem Ausland überlassen. Neben der Bearbeitung der Fragestellung soll diese Arbeit auch eine Möglichkeit zur Entwicklung von Geschäftsmodellen an Hochschulen aufzeigen.
5.4 Zusammenfassung
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Konzepts zur Vermittlung von IT-Dienstleistungen über ein Webangebot. Dabei sollen Anwenderunterunternehmen eine Leistung ausschreiben, woraufhin IT-Dienstleister einen Vorschlag zur Umsetzung einreichen.
Grundlage ist eine zweiteilige qualitative empirische Umfrage unter IT-Leitern deutscher Unternehmen. Sie ergründet, inwiefern diese Unternehmen Unterstützung im Einkauf von IT-Dienstleistungen benötigen und wie diese Unterstützung aussehen könnte. Der überwiegende Teil sieht Bedarf in der Verbesserung des Ausschreibungsprozesses und reagiert positiv auf erste Vorschläge. Größte Herausforderung für IT-Leiter ist die Anfertigung von Ausschreibungen in Vorbereitung der Vergabe einer Leitung an einen externen IT-Dienstleister. Aufgrund fehlender Vorlagen oder Handreichungen beginnt die Ausarbeitung in der Regel bei null. Dieser Sachverhalt verkompliziert den Prozess erheblich. Eine weitere Schwierigkeit liegt in den Rückfragen und der Beantwortung dieser während des Ausschreibungsprozesses. Der Aufwand zur Bewältigung dieses Prozess steigt praktisch linear mit der Anzahl der Ausschreibungsempfänger, weshalb diese von Beginn an reduziert wird. Das schränkt den Wettbewerb jedoch erheblich ein. Allgemein besteht der Wunsch nach einer Professionalisierung und Systematisierung des Prozesses.
Aufbauend auf der Befragung erfolgt die Ausarbeitung des Konzepts. Vier Basisaktivitäten bilden die Grundlage des Kundennutzens und sind als Internetangebot hochskalierbar: Research-Dokumente unterstützen IT-Mitarbeiter bei der Auswahl der passenden Lösungen. Sie bieten im Vergleich zu verfügbaren kommerziellen Angeboten einen praktischeren Ansatz für den täglichen Einsatz. Dokumentvorlagen in Form von IT-Architekturen und Leistungsbeschreibungen unterstützen die IT-Organisation bei der Anfertigung von Ausschreibungen. Sie dienen als Vorlage, die im besten Fall nur noch an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden muss. Die Dokumentvorlagen sind essentiell für die vereinfachte Ausschreibung: Wie sich in der Befragung zeigt, ist die Anfertigung dieser der schwierigste und langwierigste Teil einer Ausschreibung. Zudem existieren bislang praktisch keine öffentlichen Vorlagen.
Ein Anbieterverzeichnis bietet ein möglichst umfangreiches Verzeichnis an IT-Dienstleistern. Diese pflegen nicht nur ihr eigenes Profil, sondern auch Kundenreferenzen in Form von Fallstudien. Im Vergleich zu bestehenden Verzeichnissen der Hard- und Softwareanbieter ist dieses technologieübergreifend ausgelegt. Die Referenzen dienen dabei als Bewertungsmerkmal hinsichtlich der Projekte und Erfolge der Unternehmen. Eine Ausschreibungsplattform ermöglicht die prozessbasierte Verteilung von Ausschreibungen an IT-Dienstleister. Eine systematische Vorgehensweise bei der Beantwortung von Rückfragen entkoppelt den Aufwand einer Ausschreibung von der Anzahl der Empfänger dieser. Ergänzende Aktivitäten unterstützen Anwenderunternehmen bei der Anfertigung der Ausschreibung und im Provider-Management.
Das Geschäftsmodell basiert auf der Berechnung von Provisionen für auf der Ausschreibungsplattform vermittelte Aufträge. Diese Provisionen sind vollständig von den IT-Dienstleistern zu zahlen, sodass die Nutzung für die Anwenderunternehmen mit keinen direkten Kosten verbunden ist. Dokumente und Anbieterverzeichnis sind zwar wesentliche Bestandteile des Konzepts, tragen aber nur indirekt zum Umsatz bei.
Im Verlauf der Befragung sind bereits umfangreiche Änderungen am Konzept eingeflossen. Insbesondere die Notwendigkeit der Dokumentvorlagen, aber auch der Research-Dokumente hat sich erst im Rahmen der Interviews herausgestellt. Dies zeigt, wie wichtig eine Entwicklung nah am Kunden ist.
Die Entwicklung einer Webanwendung zeigt eine prototypische Implementierung des Konzepts auf. Ziel dieser ist die Entwicklung der Anforderungen und die Umsetzung grundlegender Funktionen.
Zwar existieren bereits verschiedene Teilelemente des Konzepts in Form von Webangeboten, doch weist keins davon durchschlagenden Erfolg auf. Grund dafür ist einerseits eine mangelnde Umsetzung dieser Angebote, wichtiger jedoch ist die Kombination der verschiedenen Aktivitäten: Nur ein integriertes und vor allem umfassendes Angebot kann IT-Verantwortliche systematisch und regelmäßig beim Einkauf von IT-Dienstleistungen unterstützen.
Grundlage des Konzepts ist die Idee des zweiseitigen Online-Marktplatzes. Darüber hinaus weist es jedoch eine Vielzahl weiterer Innovationsmuster auf. Die Dokumentvorlagen könnten als gemeinsames Projekt offen und frei zur Verfügung bereitgestellt werden. Dies würde analog zu bekannten IT-Management-Frameworks zu branchenweiten Best-Practices führen.
Das entwickelte Konzept besitzt das Potenzial für Weiterentwicklungen: Insbesondere aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklungen, wie der vermehrte Einsatz von freien Mitarbeitern und der kurzfristige und hochstandardisierte Abruf von Leistungen lassen Raum für Anpassungen. Mit einer flexiblen Organisation und einer adaptiven Webanwendung ließe sich zügig auf Marktanforderungen reagieren.
Mit der derzeit weiter voranschreitenden Ausbreitung von Cloud-Lösungen erfolgt auch eine deutliche Vereinfachung der Einführung und Wartung dieser. Langfristiges Ziel des Konzepts ist die Vereinfachung von IT-Dienstleistungen auf das Niveau eben jener Cloud-Lösungen. Verschiedenste bestehende Angebote in anderen Branchen zeigen den Bedarf an Vereinfachung von Dienstleistungen auf. Viele dieser Märkte besitzen ein Milliardenvolumen, was auch auf den Bereich der IT-Dienstleistungen zutrifft.
Diese Arbeit belegt empirisch, dass sich Anwenderunternehmen eine Lösung zur vereinfachten Ausschreibung von IT-Dienstleistungen wünschen. Sie zeigt auf, wie ein Webangebot mit einem Online-Marktplatz als Kernkomponente diesen Prozess systematisch verbessern könnte. Eine prototypische Implementierung bildet dieses Konzept in einem ersten Ansatz ab.
Diese Arbeit dient als Vorbild für die Entwicklung innovativer Konzepte und Geschäftsmodelle an Hochschulen und soll die Forschung in diesem Bereich weiter vorantreiben.
Literaturverzeichnis
- Advisen Insurance Intelligence. Industry Analysis: IT Consulting and Services. 2012. Print.
- Blank, Steven G., and Bob Dorf. The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company. K & S Ranch, 2012. Print.
- Carney, Michael. “Kinnek Raises $10M from Matrix to Help SMBs Handle Procurement like the Big Boys.” Pando. 15 Sept. 2014. Web. 21 July 2015. https://pando.com/2014/09/15/kinnek-raises-10m-from-matrix-to-help-smbs-handle-procurement-like-the-big-boys/.
- Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business. New York: Harper Business, 2011. Print.
- Freelancers Union & Elance-oDesk. Freelancers Union & Elance-oDesk. Freelancers Union & Elance-oDesk. Print.
- Galbraith, Craig. “Managed Services Market Set for Big Growth.” Channel Partners, 12 Aug. 2013. Web. 24 July 2015. http://www.channelpartnersonline.com/news/2013/08/managed-services-market-set-for-big-growth.aspx.
- Galston, Ezra. “The Trillion-Dollar Market To Remake Business Applications.” TechCrunch. 10 June 2015. Web. 21 July 2015. http://techcrunch.com/2015/06/10/show-me-the-trillion-dollar-market.
- Keeley, Larry, Ryan Pikkel, Brian Quinn, and Helen Walters. Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs. Hoboken, NJ (US): Wiley, 2013. Print.
- Kim, W. Chan, and Renee Mauborgne. Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business Review, 2015. Print.
- Osterwalder, Alexander, Yves Pigneur, and Tim Clark. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley and Sons, 2010. Print.
- PR Newswire. “Managed Services Market Worth $193.34 Billion by 2019.” 7 Jan. 2015. Web. 24 July 2015. http://www.prnewswire.com/news-releases/managed-services-market-worth-19334-billion-by-2019-287805431.html.
- Schlie, Erik, Jörg Rheinboldt, and Niko Marcel Waesche. SimplySeven: Seven Ways to Create a Sustainable Internet Business. Basingstoke (UK): Palgrave Macmillan, 2011. Print.
- Zillmann, Mario. Der Markt Für IT-Beratung Und IT-Service in Deutschland. Rep. Kaufbeuren (DE): Lünendonk, 2014. Print.